Optimierung (KVP) im Facility Management
Facility Management: Heiztechnik » Betrieb » Optimierung (KVP)
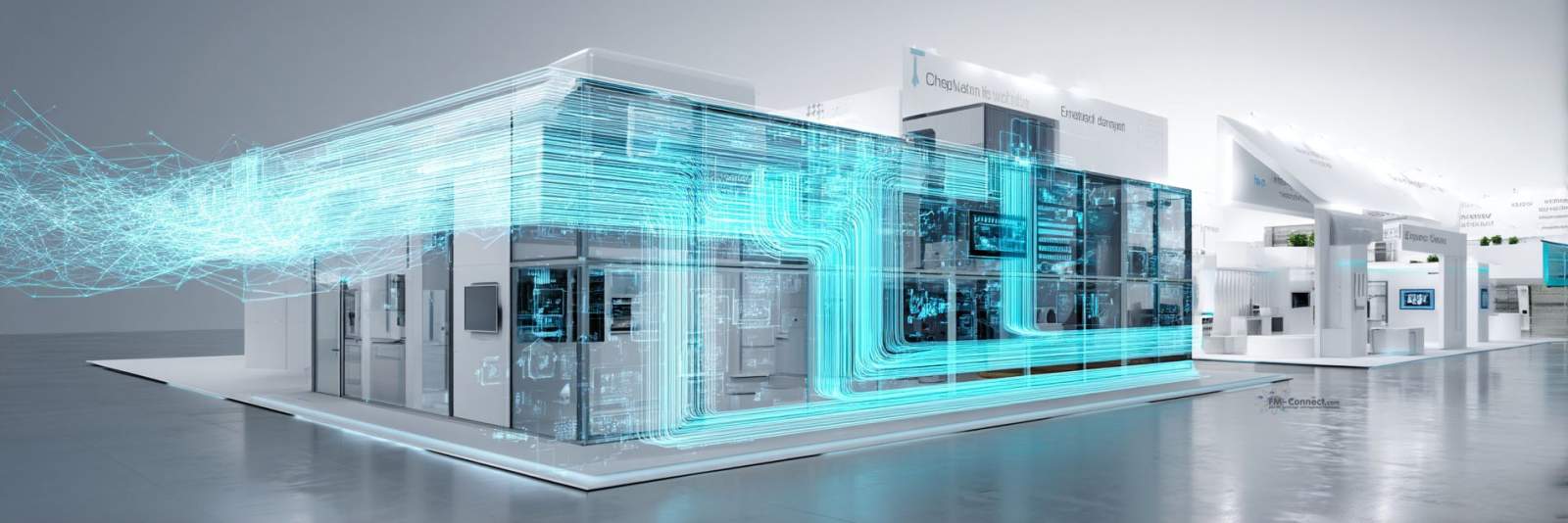
Optimierung (KVP): Heiztechnik im Betrieb
Heiztechnik ist ein zentraler Faktor für den Energieverbrauch und die Betriebskosten von Gebäuden. In vielen Nichtwohngebäuden entfallen typischerweise rund 70 % der Energiekosten auf die Raumwärme, in Schulen sogar über 80 %. Angesichts steigender Energiepreise, Klimaschutzzielen und gesetzlichen Vorgaben gewinnt die Optimierung der Heizungsanlage im laufenden Betrieb stark an Bedeutung. Der Kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP) – ein zentrales Prinzip des Qualitäts- und Energiemanagements – bietet dabei einen systematischen Ansatz, um Technik und Betriebsabläufe iterativ zu optimieren. Durch einen KVP werden Abläufe wiederholt nach Einsparpotenzialen durchleuchtet und Verbesserungen umgesetzt, was langfristig zu höherer Energieeffizienz, Kostensenkung und Nachhaltigkeit führt.
Technische Maßnahmen wie Brennwerttechnik, hydraulischer Abgleich, verbesserte Regelung und Monitoring können den Energieverbrauch typischerweise um zweistellige Prozentsätze reduzieren, wie zahlreiche Studien und Praxisbeispiele belegen (z. B. ~15 % durch Hydraulikoptimierung, ~16 % durch Regelungsanpassungen, bis zu 34 % in Einzelprojekten durch smarte Thermostate). Doch Technik allein genügt nicht: Organisationsentwicklung und Mitarbeiterengagement sind die Schlüssel, um Effizienzgewinne zu realisieren und zu erhalten. Schulungen, interne Audits, Energie-Controlling und eine digitale Informationsbasis sorgen dafür, dass Einsparpotenziale erkannt und gehoben werden.
Das Gebäudeenergiegesetz schreibt Effizienz als Standard vor, DIN-Normen liefern anerkannte Verfahren zur Bewertung und Verbesserung, zeitweilige Verordnungen wie EnSimiMaV haben den Handlungsdruck erhöht, und Förderprogramme wie die BEG unterstützen finanziell bei der Umsetzung. Die Investition in kontinuierliche Verbesserung rechnet sich dabei mehrfach: Durch reduzierte Energiekosten, durch Fördermittel, durch zufriedene Nutzer (ein gut beheiztes, aber nicht überheiztes Gebäude schafft Komfort) und durch einen Beitrag zu den Klimaschutzzielen. Gerade vor dem Hintergrund der Energiewende und steigender CO₂-Preise wird ein lernendes System im Gebäudebetrieb zum Wettbewerbsvorteil. Gelingt dies, so wird die Heiztechnik vom Kostentreiber zum Erfolgsfaktor einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Liegenschaftsbewirtschaftung.
Technische Optimierungsansätze in der Heiztechnik
Effiziente Heiztechnik erfordert eine ganzheitliche Betrachtung von Wärmeerzeugung, -verteilung und -regelung. Im Fokus stehen sowohl Modernisierung der Anlagentechnik (z. B. durch Brennwertkessel) als auch feinabgestimmte Betriebsparameter (hydraulischer Abgleich, Regelungstechnik) und Monitoring. Technische Verbesserungen lassen sich vielfach kurzfristig umsetzen und erzielen unmittelbare Einsparungen, häufig mit geringerem Investitionsaufwand als bauliche Maßnahmen. Im Folgenden werden zentrale technische Optimierungsfelder und -maßnahmen dargestellt.
Brennwerttechnik und effiziente Wärmeerzeuger
Ein erster Hebel liegt in der Optimierung der Wärmeerzeugung. Brennwerttechnik nutzt die Kondensationswärme der Abgase und erreicht so Kesselwirkungsgrade von 95–105 %, während ältere Niedertemperaturkessel einen Teil der Abwärme ungenutzt lassen. Der Wechsel von veralteter Heizkesseltechnik zur modernen Gas-Brennwerttechnik kann den Energieverbrauch um bis zu etwa 10 % senken, da zusätzlich der im Wasserdampf gebundene Wärmeanteil genutzt wird. Voraussetzung für die Ausschöpfung des Brennwert-Effekts ist allerdings eine ausreichend niedrige Rücklauftemperatur des Heizwassers, was häufig durch größere Heizflächen oder einen hydraulischen Abgleich unterstützt wird. Seit einigen Jahren schreibt der Gesetzgeber vor, dass neue Öl- und Gasheizungen im Gebäudebestand praktisch nur noch als Brennwertgerät installiert werden dürfen. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG), in Kraft seit 1. November 2020, hat frühere Regelungen abgelöst und enthält Austauschpflichten für ineffiziente Kessel: Heizkessel, die älter als 30 Jahre sind (Standardkessel), dürfen in der Regel nicht mehr betrieben werden (GEG §72). Diese Bestimmungen forcieren faktisch die Umstellung auf effiziente Brennwerttechnik im Bestand. Für die Zukunft sind noch weitergehende Anforderungen geplant – so soll ab 2024 gemäß novelliertem GEG jede energetische Bilanzierung beheizter Gebäude einheitlich nach DIN V 18599 erfolgen, was eine genaue Bewertung moderner Wärmeerzeuger und ihrer Einbindung ermöglicht. Neben Brennwertkesseln sind auch alternative Wärmeerzeuger wie Wärmepumpen oder KWK-Anlagen im Rahmen der Optimierung relevant; deren Einsatz erfordert jedoch eine individuelle Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktur.
Hydraulischer Abgleich und Optimierung der Wärmeverteilung
Ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage gehört zu den wirksamsten und zugleich vergleichsweise einfachen Optimierungsmaßnahmen im Bestand. Dabei werden alle Heizkreise und -körper so abgeglichen, dass jeder Bereich genau die erforderliche Wassermenge und Vorlauftemperatur erhält. Ohne Abgleich fließt das Heizwasser bevorzugt durch nahe gelegene Heizkörper, während entferntere Stränge unterversorgt bleiben – häufige Folge sind überhitzte Räume nahe dem Kessel und zu kalte Räume am Ende des Verteilnetzes. Ein hydraulischer Abgleich beseitigt diese Fehlverteilung und erhöht die Energieeffizienz um bis zu 15 %, wie neutrale Studien belegen. Zudem steigt der Wärmekomfort und Strömungsgeräusche in überversorgten Ventilen nehmen ab. Obwohl kein allgemeines Gesetz den Abgleich in Bestandsgebäuden direkt vorschreibt, ist er doch in öffentlichen Ausschreibungen (VOB/C DIN 18380) und technischen Regeln als Standard vorgesehen und wird von Förderprogrammen zur Pflicht gemacht. So verlangt die Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG) bei geförderten Heizungsmaßnahmen stets einen Nachweis des hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B (präzise Berechnung) durch einen Fachhandwerker oder Energieberater. Auch die befristete Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen (EnSimiMaV, 2022–2024) schrieb einen hydraulischen Abgleich verbindlich vor: In größeren Gebäuden mit zentraler Erdgasheizung (Nichtwohngebäude >1.000 m² beheizter Fläche, Wohngebäude ≥10 Wohneinheiten) war er bis 30. September 2023 durchzuführen, in Wohngebäuden mit 6–9 Einheiten bis 15. September 2024. Die Umsetzung dieser Pflicht zeigt die hohe Relevanz des Abgleichs für kurz- und langfristige Energieeinsparungen. Praktisch umfasst ein vollständiger Abgleich mehrere Schritte: Ermittlung der Heizlast pro Raum, Anpassung der Pumpenleistung, Einstellung der Vorlauftemperatur und Voreinstellung aller Thermostatventile entsprechend der berechneten Durchflussmengen. Ergänzend sollten überdimensionierte Heizungspumpen gegen hocheffiziente Pumpen ausgetauscht und ungedämmte Wärmeverteilungsrohre gedämmt werden, da auch diese Maßnahmen signifikante Einspareffekte haben. All diese Optimierungen der Verteilung werden von der BEG als Einzelmaßnahmen gefördert (Grundförderung 15 % der Kosten). Insgesamt bildet der hydraulische Abgleich die Basis dafür, dass nachfolgende Regelungsstrategien überhaupt effektiv greifen können, da nur bei korrekter Durchströmung aller Kreise die Regelungstechnik optimal arbeitet.
Regelungstechnik und Thermostatmanagement
Ein funkgesteuerter, batterieloser Thermostataufsatz an einem Heizkörper erlaubt die zentrale Steuerung der Raumtemperatur.
Neben der Erzeugungs- und Verteiltechnik stellt die Regelungstechnik das dritte wichtige Stellglied der Heizungsoptimierung dar. Moderne Mess-, Steuer- und Regelungssysteme (MSR) sorgen dafür, dass die Wärmeerzeugung dem aktuellen Bedarf angepasst wird und keine Energie verschwendet wird. Witterungsgeführte Heizungsregler etwa reduzieren die Vorlauftemperatur bei milderen Außentemperaturen automatisch. Raumthermostate und Heizungsregler sollten korrekt parametriert sein, um Überheizung und takten der Kesselanlage zu vermeiden. Ein häufiges Problem in der Praxis ist die suboptimale Abstimmung verschiedener Regelkreise: Beispielsweise laufen in komplexen Gebäuden mitunter Kühl- und Heizsystem gleichzeitig gegeneinander, oder Pumpen werden manuell auf Dauerbetrieb gestellt. Solche Fehlsteuerungen verursachen unnötigen Energieverbrauch und verschleißen die Anlagentechnik. Kontinuierliche Betriebsoptimierung bedeutet hier, die Regler und Automatiken laufend zu überprüfen und nachzujustieren (ein Kernprinzip des KVP in der Technik). In vielen Fällen genügen schon einfache Maßnahmen wie die Absenkung von Solltemperaturen nachts oder in ungenutzten Zeiten, um substanzielle Einsparungen zu erzielen. Als Faustregel gilt: Pro 1 °C abgesenkter Raumtemperatur verringert sich der Energieverbrauch um ca. 6 %. In der Praxis werden Absenkzeiten jedoch oft nicht ausgeschöpft – in Schulen etwa liefen Heizungsanlagen in der Vergangenheit teils rund um die Uhr, selbst im Sommer. Durch optimierte Zeitprogramme kann man hier „sofort zehn bis zwanzig Prozent an Energie einsparen – allein durch besseres Energiemanagement und die richtige Einstellung der Heizungsanlagen“.
Ein besonderer Fokus liegt auf dem Thermostatmanagement. Thermostatische Heizkörperventile sollten in jedem beheizten Raum vorhanden und funktionsfähig sein (Einzelraumregelung ist nach GEG Standard). In vielen Bestandsbauten sind jedoch alte Thermostate verbaut, die ungenau regeln, oder sie werden von Nutzern falsch bedient (z. B. voll aufgedreht und dann durch Fensterlüften „geregelt“). Hier setzt die Digitalisierung an: Smarte Thermostatventile ermöglichen eine zentrale Steuerung der Raumtemperaturen und eine Programmierung von Heizprofilen. Neue Systeme – wie im folgenden Praxisbeispiel – arbeiten mit Funkthermostaten, die zentral vernetzt sind. So hat in einem Krankenhaus die Nachrüstung von batterielosen Funk-Thermostatventilen mit zentraler Leitstelle ermöglicht, dass nachts und in unbenutzten Räumen automatisch die Temperatur abgesenkt wird. Zusätzlich wurden Fenstersensoren integriert, die beim Lüften das Heizventil schließen. Diese intelligente Regelstrategie führte unmittelbar zu einer drastischen Reduzierung des Heizenergieverbrauchs: Im konkreten Fall konnten bis zu 40 % der Heizenergie eingespart werden, was rund 224.000 € Heizkosten pro Jahr entsprach. Dieses Beispiel verdeutlicht das enorme Potenzial moderner Regelungstechnik in Kombination mit einem konsequenten Energiemanagement. Auch ohne High-Tech-Aufrüstung sollten Facility Manager sicherstellen, dass vorhandene Regler richtig eingestellt sind: Vorlauftemperatur-Kurven nicht zu hoch, Nachtabschaltung oder -absenkung aktiviert, automatische Sommerabschaltung der Heizungspumpen etc. Regelmäßig (z. B. saisonal) sind die Parameter zu überprüfen – idealerweise unterstützt durch Messdaten aus dem Monitoring, wie im Folgenden ausgeführt.
Monitoring und Wärmemengenerfassung
Technisches Monitoring der Gebäudetechnik: Ein Ingenieur analysiert Betriebsdaten einer Heizungs- und Lüftungsanlage am Bildschirm, um Optimierungspotenziale zu erkennen.
Ein kontinuierliches Monitoring der Anlagenperformance ist unverzichtbar, um den KVP datengestützt voranzutreiben. Nur was messbar ist, kann gezielt verbessert werden – dieses Motto gilt besonders im Energiemanagement. In modernen Gebäuden liefert die Gebäudeautomation bereits enorme Datenmengen über Temperaturen, Laufzeiten, Ventilstellungen, Verbräuche etc. Wer diesen „Datenschatz aus der automatisierten Regelung der Gebäudetechnik zu nutzen versteht, spart Energie und Kosten“. Über ein Technisches Monitoring lassen sich Abweichungen vom Optimalbetrieb frühzeitig erkennen: Beispielsweise zeigte sich in einem Bürogebäude in München durch Auswertung der GA-Daten, dass zwei Kältemaschinen im Minutentakt an- und ausgingen, anstatt lastgerecht zu modulieren. Ursache war eine mangelhafte Parametrierung der Steuerung. Durch gezielte Neukonfiguration der Anlagen konnte der Energiebedarf dieses Gebäudes um 16 % gesenkt werden – ein Beleg dafür, welche Reserven selbst in neuen Gebäuden oft noch stecken. Technisches Monitoring wird in der Fachwelt zunehmend standardisiert; so gibt es etwa die Richtlinie VDI 6041 für technisches Monitoring von Gebäuden, und öffentliche Auftraggeber fordern in Neubauprojekten vermehrt ein Monitoring während der ersten Betriebsjahre ein (z. B. gemäß AMEV Technisches Monitoring 2025). Auch im Bestand lohnt sich die Nachrüstung von Monitoring-Systemen: Bereits einfache Energiecontrolling-Software oder Smart-Metering-Lösungen ermöglichen es, Verbrauchsdaten (Wärmemengen, Temperaturen) zu sammeln und auszuwerten. Wärmemengenzähler und Heizkostenverteiler sind in größeren Wohnanlagen schon aus abrechnungstechnischen Gründen Pflicht (gemäß Heizkostenverordnung), doch im Sinne des KVP sollten deren Daten auch aktiv für Optimierungszwecke genutzt werden. Seit der Novelle der HeizkostenV 2021 müssen funkende Zähler den Bewohnern monatliche Verbrauchsinformationen bereitstellen, was zu mehr Bewusstsein und Sparverhalten führen soll. Für das Facility Management bieten solche Daten die Chance, ungewöhnliche Verbrauchsmuster (z. B. stark steigender Wärmeverbrauch in einzelnen Gebäudeteilen) zu erkennen und die Ursachen zu analysieren (etwa Defekte, geändertes Nutzungsverhalten oder Steuerungsprobleme). Energiemanagementsysteme nach ISO 50001 institutionalieren dieses Vorgehen: Sie basieren auf dem Plan-Do-Check-Act-Zyklus und fordern ein kontinuierliches Messen, Überprüfen und Verbessern der energiebezogenen Leistungen. So wird der KVP auch organisatorisch verankert. Insgesamt gilt: Die Investition in Monitoring und Messdatenauswertung rechtfertigt sich durch langfristige Einsparungen und den sicheren Nachweis von Erfolg oder Misserfolg einzelner Maßnahmen.
Zusammenfassend bieten technische Optimierungsmaßnahmen – von der Brennwerttechnik über den hydraulischen Abgleich bis zur intelligenten Regelung und kontinuierlichem Monitoring – ein erhebliches Einsparpotenzial. Sie sollten integraler Bestandteil des Betriebsführungskonzepts im Facility Management sein. Im nächsten Schritt werden die organisatorischen Aspekte betrachtet, die diese technischen Maßnahmen ergänzen und dauerhaft absichern.
Organisatorische KVP-Ansätze im Betrieb
Technische Verbesserungen können ihr volles Potenzial nur entfalten, wenn sie von passenden organisatorischen Strukturen und Prozessen begleitet werden. Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess im Facility Management erfordert Management-Methoden, Schulungen und Kontrollen, die die Energieeffizienz zur laufenden Aufgabe machen. Gerade das Betriebspersonal vor Ort spielt eine Schlüsselrolle – es kann Verbesserungen aktiv vorantreiben oder durch unsachgemäßen Betrieb zunichtemachen. Im Folgenden werden einige wesentliche organisatorische KVP-Ansätze dargestellt: Mitarbeiterschulungen, internes Auditing, Prozessanalyse, Digitalisierung und Energiecontrolling. Diese greifen ineinander und schaffen eine Kultur des Energiesparens und der kontinuierlichen Optimierung.
Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter
Mitarbeiterschulungen im Facility Management – von Haustechnikern über Hausmeister bis hin zu Nutzern der Gebäude – sind essenziell, um ein Bewusstsein für energieeffizienten Betrieb zu schaffen. Das technische Personal muss die anerkannten Regeln der Technik kennen (z. B. VDI-Richtlinien für den Betrieb von heiztechnischen Anlagen) und wissen, wie Optimierungen praktisch umzusetzen sind. Schulungen zu Themen wie „optimales Einstellen der Heizungsregelung“, „Durchführen eines Heizungschecks nach DIN EN 15378“ oder „energiesparendes Nutzerverhalten“ stellen sicher, dass Verbesserungsmaßnahmen nicht einmalig bleiben, sondern dauerhaft gelebt werden. Auch Nutzeraufklärung fällt in diesen Bereich: Lehrkräfte an Schulen, Pflegepersonal in Krankenhäusern oder Büromitarbeiter sollten z. B. informiert sein, wie sie richtig lüften und heizen, um Energie zu sparen, ohne Komforteinbußen. Praxis zeigt, dass engagierte Einzelpersonen in Einrichtungen oft den Unterschied machen: „Wenn Schulen Energie sparen, liegt das oft an einzelnen Personen.“ Ein Beispiel ist eine Lehrerin, die in ihrer Schule Heizzeiten und Thermostate sinnvoll justiert und so beträchtliche Einsparungen erzielt. Erfolgsprojekte wie das seit 1996 laufende Fifty/fifty-Programm an Schulen setzen genau hier an – durch eine Mischung aus technischer Beratung und pädagogischer Einbindung werden durchschnittlich 8 % Heizenergie eingespart. Schulungen und Motivation des Personals erzeugen also Multiplikatoreffekte. Im Zuge des KVP sollten Schulungen nicht als einmalige Aktion verstanden werden, sondern regelmäßig aufgefrischt und an neue Technologien angepasst werden. Beispielsweise erfordert die Einführung eines neuen Gebäudeleittechnik-Systems intensive Trainings, damit die Betreiber alle Optimierungsmöglichkeiten ausschöpfen können.
Internes Auditing und Qualitätssicherung
Ein weiterer Baustein ist das interne Auditing im Energiemanagement. Darunter versteht man die regelmäßige, systematische Überprüfung der betrieblichen Abläufe und Einstellungen im Hinblick auf Energieeffizienz. Ein internes Audit kann z. B. jährlich durch die Energiebeauftragten oder extern unterstützt stattfinden, um Fragen zu klären wie: Werden die empfohlenen Absenkzeiten tatsächlich eingehalten? Sind die Pumpenkennlinien noch optimal eingestellt? Wurden die im Energiebericht letzten Jahres identifizierten Maßnahmen umgesetzt? Diese Audits dienen der Qualitätssicherung im KVP – sie decken Abweichungen auf und initiieren Korrekturmaßnahmen. In großen Unternehmen sind Energiemanagement-Audits teilweise vorgeschrieben: Nach dem Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) müssen Nicht-KMU alle 4 Jahre ein Energieaudit nach DIN EN 16247-1 durchführen lassen oder alternativ ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 betreiben. Tatsächlich hat die EnSimiMaV hier einen Schritt weiter gefordert: Unternehmen mit >10 GWh Energieverbrauch pro Jahr waren verpflichtet, im letzten Energieaudit identifizierte wirtschaftliche Effizienzmaßnahmen innerhalb von 18 Monaten umzusetzen. Die erfolgreiche Umsetzung musste von Auditoren bestätigt werden und die Wirtschaftlichkeit nach DIN EN 17463 (VALERI-Methode) belegt sein. Dies zeigt, dass Auditing nicht nur Dokumentation sein darf, sondern konkrete Verbesserungen nach sich ziehen muss. Für das Facility Management im Alltag lässt sich daraus ableiten, intern einen KVP-Manager oder Energieteam zu etablieren, das fortlaufend Kennzahlen erfasst, Prüfungen vornimmt und Berichte an die Leitung erstellt. Die Ergebnisse interner Audits sollten transparent kommuniziert und in aktionsorientierte Pläne übersetzt werden. Somit wird sichergestellt, dass Optimierungspotenziale nicht im Tagesgeschäft untergehen, sondern planmäßig verfolgt werden.
Prozessanalyse und kontinuierliche Optimierung der Abläufe
KVP bedeutet auch, Betriebsprozesse selbst immer wieder zu hinterfragen. Im technischen Facility Management sind Prozesse wie Wartung, Störungsmanagement, Nutzerbeschwerden oder Energieabrechnung relevant. Eine gründliche Prozessanalyse kann ineffiziente Abläufe identifizieren – z. B. zu lange Reaktionszeiten bei Heizungsstörungen oder parallele Zuständigkeiten, die Optimierungen verzögern. Lean-Management-Prinzipien sind hier anwendbar: Das Konzept des Lean Facility Management betont das Eliminieren von Verschwendung und die iterative Verbesserung von Prozessen. Beispielsweise könnte der Prozess der Heizungswartung optimiert werden, indem Wartungs- und Inspektionsintervalle nach tatsächlichem Bedarf (z. B. durch Zustandsmessungen) ausgerichtet werden, statt starr kalendarisch. Oder der Ablauf zur Einstellung von Regelungsparametern könnte standardisiert werden: Etwa ein „Heizungs-Optimierungs-Protokoll“, das jedes Jahr im Herbst und Frühjahr abgearbeitet wird (inkl. Überprüfung der Thermostate, Absenkzeiten, Hydraulik etc.). Durch solche Standardisierung und zyklische Prozessdurchläufe wird KVP institutionalisiert. Methodisch können Werkzeuge wie PDCA-Zyklen (Plan-Do-Check-Act) eingesetzt werden: Man plant eine Änderung (z. B. Absenkung der Raum-Solltemperatur um 1 °C), führt sie testweise durch, misst die Auswirkungen (Energieverbrauch, Komfortrückmeldungen) und entscheidet dann, ob die Maßnahme dauerhaft implementiert oder angepasst wird. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen unmittelbar in die nächste Planungsrunde ein – ein sich selbst verstärkender Verbesserungszyklus. Wichtig ist, dass das Leitungspersonal im Facility Management diese Kultur fördert: Mitarbeitende sollen ermutigt werden, Verbesserungsvorschläge einzubringen (z. B. im Rahmen von Energie-Ideenwettbewerben oder KVP-Workshops). Eine offene Fehler- und Lernkultur trägt dazu bei, dass Prozessschwächen erkannt und behoben werden, statt ineffiziente Routinen jahrelang fortzuschreiben.
Digitalisierung und Dokumentation
Die Digitalisierung spielt als Enabler für den KVP eine große Rolle. Viele der oben genannten Maßnahmen – vom Monitoring bis zur Prozessoptimierung – lassen sich durch digitale Tools effektiver gestalten. Ein Computerized Maintenance Management System (CMMS) bzw. CAFM-System kann beispielsweise Wartungs- und Prüfprozesse digital abbilden und durch Erinnerungen sicherstellen, dass kein Optimierungstermin versäumt wird. Digitale Checklisten (etwa für den Heizungscheck nach DIN EN 15378) erleichtern es, die Ergebnisse systematisch zu erfassen und im Zeitverlauf zu vergleichen. Auch die Dokumentation aller Einstellungen und Maßnahmen ist essenziell: Nur wenn z. B. die aktuelle Pumpeneinstellung, die letzten hydraulischen Abgleiche und die Regelkurven dokumentiert sind, kann ein neuer Mitarbeiter im Störfall fundiert eingreifen oder die Wirkung früherer Änderungen nachvollziehen. Digitalisierung ermöglicht hierbei eine zentrale Ablage und Auswertung solcher Daten. Zudem eröffnen moderne Technologien wie IoT-Sensorik und Cloud-Plattformen neue Möglichkeiten im Energiemanagement: Von intelligenten Raumfühlern, die Belegungsdaten erfassen, bis zu KI-Algorithmen, die Anomalien im Verbrauch automatisch detektieren, steht eine Fülle an Innovationen bereit. Allerdings muss das Facility Management diese Tools gezielt auswählen und in die Organisation integrieren. Digitale Projekte sollten immer mit dem KVP-Gedanken verknüpft sein: z. B. Einführung eines Dashboards für Energiekennzahlen mit dem Ziel, monatliche Review-Meetings abzuhalten, in denen Abweichungen diskutiert werden. Die Transformation analoger Abläufe in digitale Workflows kann selbst als KVP-Prozess gestaltet werden, der schrittweise erfolgt und das Personal mitnimmt (Schulung in neuer Software, Pilotprojekte, Feedbackschleifen). Letztlich erhöht Digitalisierung die Transparenz – ein Schlüsselfaktor, um Verbesserungsbedarf zu erkennen und belegbar zu machen, dass Maßnahmen wirken.
Energiecontrolling und Management-Systeme
Zentraler Bestandteil eines organisatorischen KVP ist das Energiecontrolling. Darunter versteht man das laufende Messen, Auswerten und Berichten von Energiedaten sowie das Ableiten von Steuerungsmaßnahmen. In vielen Organisationen wird hierzu ein Energiebericht jährlich oder quartalsweise erstellt, der Kennzahlen wie kWh/m², Heizgradtage-bereiniger Verbrauch, Leistungsspitzen usw. enthält. Wichtig ist, diese Daten nicht nur zu sammeln, sondern aktiv zu nutzen: im Managementreview diskutieren, Ziele festlegen (z. B. „10 % Reduktion des Wärmeverbrauchs in drei Jahren“), Maßnahmen zuordnen und Verantwortlichkeiten benennen. Hier zeigt sich die hohe Wirksamkeit von Energiecontrolling: Allein durch systematisches Monitoring und Betriebsoptimierung von Heizungs- und Lüftungsanlagen lassen sich – wie erwähnt – 10–20 % Einsparung realisieren, oft ohne Investitionen. Für professionelles Energiecontrolling bietet sich die Implementierung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001 an. Diese international anerkannte Norm fordert die Einrichtung einer Energiepolitik, Zielsetzungen, Aktionspläne und regelmäßige interne Audits – also einen institutionalisierten KVP in Energiethemen. Unternehmen, die ISO 50001 einführen, berichten häufig von anhaltenden Verbesserungen, da die Norm die kontinuierliche energetische Verbesserung zum verpflichtenden Element macht. Auch Nicht-zertifizierte Einrichtungen können sich an diesem Framework orientieren. GEFMA (German Facility Management Association) bietet etwa Leitfäden an, wie FM-Unternehmen durch ihre Prozesskenntnis Energiemanagement-Aufgaben beim Kunden unterstützen können. Zudem bringen Energiemanager oder KVP-Manager im Unternehmen die nötige fachliche Expertise ein, um Daten korrekt zu interpretieren und Verbesserungsideen zu entwickeln. Schließlich sollte Energiecontrolling immer auch die Wirtschaftlichkeit im Blick haben: Es werden nicht nur kWh eingespart, sondern auch Kosten. Maßnahmen, die sich innerhalb der Nutzungsdauer amortisieren, sollten prioritär umgesetzt werden – wie es die EnSimiMaV mit der Verweisung auf DIN EN 17463 (Kosten-Nutzen-Berechnung über Kapitalwert) für große Verbraucher vorgeschrieben hatte. Durch ein konsequentes Controlling können erreichte Einsparungen belegt und intern kommuniziert werden, was wiederum die Motivation von Mitarbeitern und Entscheidern erhöht, den Verbesserungsprozess fortzusetzen.
Insgesamt ergänzen die organisatorischen Ansätze die technischen Maßnahmen ideal: Während technische Optimierung einmalige Effizienzsprünge ermöglicht, sorgt der organisatorische KVP dafür, dass diese Erfolge verstetigt, erweitert und nicht durch Nachlässigkeit wieder aufgehoben werden. Besonders in unterschiedlichen Gebäudetypen – vom Krankenhaus bis zur Wohnanlage – zahlt sich die Kombination aus Technik und Organisation unterschiedlich aus, wie im nächsten Abschnitt beleuchtet wird.
Anwendung in verschiedenen Gebäudetypen
Gebäude unterscheiden sich erheblich in ihrer Nutzung, ihren betrieblichen Anforderungen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Folglich müssen KVP-Maßnahmen im Facility Management an den Gebäudetyp angepasst werden. Die Prinzipien bleiben zwar gleich (Energieeffizienz steigern, Kosten senken, Betriebssicherheit gewährleisten), doch Prioritäten und konkrete Umsetzungen variieren. Im Folgenden werden exemplarisch Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Verwaltungsgebäude und Wohnanlagen betrachtet. Für jeden Typ werden spezifische Herausforderungen und erfolgreiche Optimierungsansätze aufgezeigt, gestützt durch Praxisbeispiele.
Krankenhäuser
Krankenhäuser weisen einen hohen Energiebedarf auf und stellen besondere Anforderungen an die Heiztechnik. Zum einen sind Krankenhäuser meist rund um die Uhr in Betrieb – eine Temperaturabsenkung über Nacht ist in sensiblen Bereichen (Stationen, OP-Bereiche) nur begrenzt möglich. Zum anderen bestehen strenge hygienische Vorgaben, etwa eine konstant hohe Trinkwarmwasser-Temperatur zur Legionellenprävention. Laut Studien entfallen 40–60 % der gesamten Energiekosten eines Krankenhauses auf Heizung, Lüftung und Klimatisierung, wobei die Wärmeversorgung oft den Löwenanteil stellt. Optimierungsmaßnahmen müssen daher sorgfältig abgewogen werden, um den Patientenkomfort und die Sicherheit nicht zu beeinträchtigen. Technisch stehen in Krankenhäusern häufig Großkessel oder sogar BHKW (Blockheizkraftwerke) im Einsatz. Die Einführung von Brennwerttechnik (sofern noch nicht vorhanden) oder der Tausch alter Kessel kann hier große Effekte haben – bei mehreren Megawatt Heizlast summiert sich schon eine 10 % Effizienzsteigerung zu enormen Einsparungen. Hydraulischer Abgleich ist auch in Krankenhäusern wichtig, vor allem weil weitläufige Verteilsysteme mit vielen Strängen (Verwaltungsflügel, Bettenhäuser, etc.) bestehen. In der Praxis wurde jedoch beobachtet, dass in vielen Kliniken Teilbereiche deutlich überversorgt werden, während andere gerade genug Wärme erhalten. Ein Abgleich schafft hier nicht nur Energieeinsparung, sondern verbessert auch die thermische Behaglichkeit für Personal und Patienten.
Größtes Potenzial liegt erfahrungsgemäß in der Regelungstechnik: Krankenhäuser besitzen komplexe Gebäudeleittechnik-Systeme, doch diese werden nach Bauabnahme oft nicht ausreichend nachjustiert. Beispielsweise laufen Heizungs- und Lüftungsanlagen teils nach Standardsettings weiter, obwohl sich die Nutzungsprofile geändert haben (etwa Schließung von Stationen oder neue OP-Zeiten). Ein kontinuierliches Monitoring und Nachregeln ist hier essenziell. So können etwa OP-Bereiche außerhalb der Nutzungszeiten auf niedrigere Grundtemperatur geschaltet werden (sofern baulich getrennt), ohne die Patientensicherheit zu gefährden. Ein Praxisbeispiel zeigt eindrucksvoll die Möglichkeiten: In einer Klinik wurde durch den Einbau zentral steuerbarer Funkthermostate in Verwaltungs- und Untersuchungsräumen eine Temperaturabsenkung nach Feierabend realisiert. Zusätzlich gab es eine automatisierte Nachtabsenkung in weniger kritischen Bereichen. Das Resultat war eine Energieeinsparung von rund 34 % der Heizenergie innerhalb kurzer Zeit. Dies unterstreicht, dass selbst in 24/7-Einrichtungen erhebliche Einsparungen möglich sind, wenn man die Nutzungscharakteristik zonenweise berücksichtigt. Organisatorisch ist im Krankenhaus wichtig, dass es einen Energieteam gibt, das die Maßnahmen koordiniert – typischerweise den Technischen Leiter, Energiemanager und die Haustechniker. Schulungen des Personals (z. B. „Energiesparendes Verhalten im Klinikalltag“) können Bewusstsein schaffen, etwa darauf zu achten, Türen zwischen unterschiedlich temperierten Bereichen geschlossen zu halten oder keine mobilen Heizgeräte zu verwenden. Zudem stehen für Krankenhäuser Fördermittel bereit, wie das BAFA-Programm für Abwärmenutzung oder das BEG für größere Sanierungsmaßnahmen, die man einbinden sollte. Auch spezielle Gesetze wie die EnSimiMaV hatten Einfluss: Sie verpflichtete Kliniken mit Erdgasheizung ebenfalls zum Heizungscheck und hydraulischen Abgleich (Krankenhäuser fielen unter Nichtwohngebäude >1000 m²). Viele Krankenhausträger haben diese Vorgaben genutzt, um längst überfällige Optimierungen vorzunehmen – ein Beispiel dafür, wie regulatorischer Druck positive Effekte im Facility Management auslösen kann.
Bildungseinrichtungen (Schulen, Hochschulen)
Schulen und andere Bildungseinrichtungen zeichnen sich durch diskontinuierliche Nutzung aus: Unterricht findet wochentags tagsüber statt, abends, nachts und am Wochenende stehen die Gebäude meist leer. Diese klare Trennung von Nutzungs- und Freizeiten bietet ein enormes Einsparpotenzial durch Zeitsteuerung der Heizung. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass viele Schulen hier Nachholbedarf haben – in der Vergangenheit liefen Heizungsanlagen teilweise rund um die Uhr, oft aus Unkenntnis oder „um sicherzugehen“. Ein erster Schritt der Optimierung besteht darin, die Heizzeiten strikt am Bedarf auszurichten: morgens rechtzeitiges Aufheizen vor Unterrichtsbeginn (ggf. mit Witterungsfühler, um früher zu starten bei sehr kaltem Wetter), automatische Absenkung kurz nach Unterrichtsende, komplette Abschaltung an Wochenenden (außer Frostschutz). Die meisten schulischen Heizungssteuerungen bieten solche Timer-Funktionen, müssen aber korrekt programmiert werden. Hier ist die Zusammenarbeit zwischen Hausmeister und zentraler Gebäudewirtschaft wichtig. Manchmal sind die Steuerungen zentral bei der Stadtverwaltung aufgeschaltet, dann muss dort angesetzt werden. Ein Erfolgskonzept ist es, Hausmeisterschulungen durchzuführen und Energiebeauftragte pro Schule zu benennen. Das bereits erwähnte fifty/fifty-Programm des UfU e.V. (Unabhängiges Institut für Umweltfragen) motiviert Schulen zusätzlich dadurch, dass ein Teil der eingesparten Energiekosten im Schulbudget verbleibt – ein Anreizsystem, das vorbildliche Resultate brachte. Durchschnittlich senkten teilnehmende Schulen ihren Wärmeverbrauch um 8 %, in einzelnen Städten wie Potsdam sogar um 13 % innerhalb eines Jahres. Diese Erfolge wurden „durch eine Mischung aus technischer Beratung und Pädagogik“ erreicht – d.h. der Mix aus technischen Maßnahmen (Hydraulikcheck, Thermostatkorrekturen, Lüftungsoptimierung) und Verhaltensänderung (Sensibilisierung von Lehrkräften und Schülern) war entscheidend.
Technisch sind Schulen oft einfachere Objekte als Krankenhäuser – die Heiztechnik umfasst üblicherweise zentral einen Kessel (heutzutage meist Brennwert-Gas oder eine Nahwärmeübergabestation) und ein einfaches Verteilnetz zu den Klassenräumen. Hydraulischer Abgleich ist dennoch sinnvoll, insbesondere in weitläufigen Schulgebäuden mit mehreren Flügeln oder Stockwerken, um ferne Klassenräume ausreichend zu versorgen und nahe gelegene nicht zu überhitzen. Die Investitionskosten dafür sind moderat und werden teils über kommunale Förderprogramme getragen. Thermostatmanagement spielt ebenfalls eine Rolle: In Klassenräumen sollten Thermostate nicht manipuliert oder verdeckt werden. Manche Schulen wählen mittlerweile fest eingestellte oder abschließbare Thermostatventile, um ein einheitliches Temperaturniveau zu halten (z. B. 20 °C in Klassenräumen). Allerdings kann das zu Komfortkonflikten führen; besser ist es meist, durch Aufklärung die richtige Bedienung zu fördern und ggf. smarte Thermostate einzusetzen, die zentral überwacht werden können. So ließe sich erkennen, falls einzelne Räume dauerhaft auf Maximum stehen, und gegensteuern. Lüftungsverhalten beeinflusst die Heizenergie in Schulen ebenfalls stark (Thema Stoßlüften vs. Dauerkippen der Fenster). Auch hier ist Aufklärung nötig, ggf. unterstützt durch technische Hilfen wie Fensterkontakte oder CO₂-Sensoren, die anzeigen, wann Lüften nötig ist. Organisatorisch empfiehlt es sich, den Energieverbrauch der Schule transparent zu machen – etwa ein Energie-Aushang im Schulfoyer mit dem monatlichen Wärmeverbrauch und Vergleich zum Vorjahr. Einige Schulen haben Energie-AGs von Schülern gegründet, die Einsparideen entwickeln und z.B. "Energiedetektive" einsetzen, die nach Unterricht die Fenster schließen und das Licht ausmachen. Solche Initiativen binden die Nutzer aktiv ein und unterstützen den KVP auf breiter Front. Hochschulen ähneln in mancher Hinsicht Schulen, haben aber oft komplexere Labor- und Bürogebäude. Dort sind zusätzlich Lüftungsanlagen zu betrachten, doch auch hier gilt: bedarfsgeführter Betrieb (z. B. CO₂-gesteuert) und klare Abschaltzeiten bringen viel. Insgesamt kann man in Bildungseinrichtungen mit vergleichsweise einfachen Mitteln deutliche Erfolge erzielen – 10–20 % Einsparung allein durch organisatorisch-technische Optimierung wurden von DENEFF für Schulen genannt. Die Herausforderung bleibt, diese oftmals öffentlich betriebenen Gebäude in den Fokus zu rücken, da die Nutzer (Schulen) die Energiekosten nicht direkt im Budget spüren. Programme wie fifty/fifty schaffen dafür Anreize und sind Teil des KVP auf höherer Ebene (Kommune, Land).
Verwaltungs- und Bürogebäude
Verwaltungsgebäude (Bürogebäude, Behördenzentralen, Verwaltungsbauten) weisen in der Regel geregelte Arbeitszeiten auf und sind außerhalb dieser Zeiten wenig genutzt. Ähnlich wie bei Schulen liegt hier ein Schwerpunkt auf der Zeitschaltung der Heiz- und Klimasysteme: Außerhalb der Kernarbeitszeit sollte die Temperatur abgesenkt werden, gegebenenfalls am Wochenende nur eine Grundtemperierung erfolgen. Moderne Bürogebäude verfügen häufig über eine Gebäudeautomation, die Heizung, Kühlung, Lüftung und Beleuchtung koordiniert. Allerdings – wie das Beispiel des Münchner Bürogebäudes zeigt – heißt Automation nicht automatisch optimaler Betrieb. Oft sind die Systeme anfangs mit Default-Einstellungen in Betrieb gegangen und wurden nie feinjustiert. Typische Probleme in Büros sind z. B. Simultanheizen und -kühlen (gleichzeitiger Betrieb von Kühlgeräten und Heizkörpern in Übergangszeiten) oder überhöhte Grundlasten (Pumpen laufen 24/7, Lüftungsanlagen schalten nicht ab). Durch ein gezieltes Betriebsoptimierungsprojekt lassen sich hier enorme Potenziale heben. Im erwähnten Gebäude in München konnten durch das Anpassen der GA-Parameter (Unterdrückung unnötiger Volllast-Takte, Optimierung der Regelkurven) 16 % Energieeinsparung erreicht werden. Dies ist kein Einzelfall – Untersuchungen zeigen, dass zweistellige Prozentbeträge in vielen bestehenden Bürogebäuden möglich sind, wenn Fachleute die Betriebsdaten analysieren und nachregeln. Daher ist es sinnvoll, insbesondere bei größeren Verwaltungsbauten periodische Effizienz-Checks durchzuführen, etwa alle paar Jahre einen externen Energieberater oder TGA-Spezialisten hinzuzuziehen, der die Einstellungen prüft (ähnlich einem Audit). Manche Organisationen schließen dafür Energie-Performance-Contracting ab, wo ein Dienstleister Einsparmaßnahmen umsetzt und sich aus den Einsparungen bezahlt.
Technisch sind in Bürobauten Variable Volume Air Systems, Fan-Coils oder Klimadecken als Heiz-/Kühlsystem verbreitet. Die Verzahnung von Heizung und Klimaanlage erfordert besondere Aufmerksamkeit: Beispielsweise sollte eine Klimaanlage nicht kühlen, wenn Heizkörper noch warme Vorlauftemperaturen erhalten. Hier kann eine gegenseitige Verriegelung oder ein abgestimmtes Temperaturband helfen (Heizung aus, sobald Kühlung anfordert und umgekehrt). Die Nutzersteuerung ist ein weiterer Aspekt: In vielen Büros können Mitarbeiter über Thermostate oder Raumregler eingreifen. Es hat sich bewährt, diesen Regelungsgrad zu beschränken (z. B. Einstellbereich 20–24 °C statt max. Heizstufe), um Exzesse zu vermeiden. Gleichzeitig sollte aber Beschwerdemanagement vorhanden sein – frierende Mitarbeiter stellen sonst eigene Heizlüfter auf, was ineffizient ist. Daher muss das FM hier sensibel vorgehen, etwa durch Kalibrierung der Fühlertemperaturen und gute Kommunikation („ein Grad weniger spart 6 % Energie, bitte unterstützen Sie uns dabei“). Organisatorisch ist in Verwaltungsgebäuden oft ein Energiemanagement-Team etabliert, insbesondere in größeren Unternehmen oder Behörden. Dieses Team kann regelmäßige Rundgänge machen (Heizungs-Check, Fenster-Check) und Energiesparmaßnahmen koordinieren. Ein Erfolgsfaktor ist auch das Bewusstsein des Managements: Wenn die Leitung Einsparziele vorgibt und Erfolge sichtbar anerkennt, ziehen alle besser mit. Manche Unternehmen koppeln inzwischen Nachhaltigkeitsziele (inkl. Energie) an die Leistungskennzahlen von Standortleitern, was den Fokus stärkt.
Regulatorisch fallen Verwaltungsgebäude unter die selben Gesetze wie andere Gebäude: GEG und (bis 2024) EnSimiMaV, falls z.B. mit Gas beheizt. Letztere Verordnung enthielt auch Vorgaben für öffentliche Liegenschaften (in der parallelen Kurzfristmaßnahmen-Verordnung EnSikuMaV gab es z.B. Höchsttemperaturen für Büros von 19 °C in der Heizperiode 22/23). Solche äußeren Vorgaben kann das FM als Anlass nehmen, intern Maßnahmen durchzusetzen, die vorher auf Widerstände gestoßen sind. So berichteten einige Kommunen, dass die temporäre Vorschrift der Absenkung in öffentlichen Gebäuden eine dauerhafte Sensibilisierung bewirkte, die Verbrauchswerte deutlich senkte. Abschließend sei erwähnt, dass Bürogebäude zunehmend mit Digitalisierung ausgestattet werden (Smart Building-Technologien, Präsenzmelder, automatische Jalousien etc.). Diese Systeme müssen jedoch ganzheitlich optimiert werden – z.B. sollten automatische Jalousien so gesteuert sein, dass im Winter solare Gewinne genutzt werden (Heizenergieeinsparung) und im Sommer Überhitzung vermieden wird (Kühlenergieeinsparung). Ein integrales Energiemanagement berücksichtigt alle diese Faktoren und ist somit ein Paradebeispiel für KVP: ständige Anpassung an veränderte Nutzungen (z.B. mehr Homeoffice, andere Belegung) und technische Verbesserungen.
Wohnanlagen
Wohngebäude und -anlagen stellen insofern einen Sonderfall dar, als hier die einzelnen Bewohner erheblichen Einfluss auf den Energieverbrauch haben. Im Mietwohnungsbau obliegt zwar die zentrale Heizungsanlage dem Gebäudemanagement (Hausmeister, Wohnungswirtschaft), doch jeder Haushalt reguliert seine Raumtemperaturen individuell. Die Optimierung im Sinne des KVP muss daher sowohl die zentrale Anlageneffizienz verbessern als auch das Nutzerverhalten adressieren. Technisch sind viele Maßnahmen analog zu Nichtwohngebäuden: Ein hydraulischer Abgleich ist in Mehrfamilienhäusern absolut empfehlenswert – er sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung über alle Wohnungen und verhindert die typische Situation, dass obere Stockwerke zu heiß und untere zu kalt sind. Bemerkenswert: Die EnSimiMaV verpflichtete selbst kleinere Wohnanlagen (ab 6 Wohneinheiten) bis 2024 zum hydraulischen Abgleich, was zeigt, dass man hier erhebliche ineffiziente Reserven vermutete. Insbesondere in älteren Altbauten mit nachträglicher Wärmedämmung kann ein Abgleich ~10–15 % Brennstoffeinsparung bringen, da vorher oft Überdimensionierungen vorlagen. Niedertemperaturbetrieb der Heizung ist ein weiterer Punkt: In gut gedämmten Wohngebäuden kann die Vorlauftemperatur abgesenkt werden, gerade in der Übergangszeit. Moderne Brennwertthermen modulieren selbst, aber nur wenn die Systemparameter (z. B. Heizkurve) richtig eingestellt sind. Hier sollte das Facility Management, ggf. mit einem Energieberater, die Einstellungen optimieren – ein klassischer KVP-Schritt mit Messung (z.B. Vor-/Rücklauf-Temperaturen loggen) und Anpassung (Heizkurve flacher stellen, Nachtabsenkung aktivieren etc.).
Wärmemengenzähler spielen in Wohnanlagen bereits wegen der Heizkostenabrechnung eine große Rolle. In Deutschland schreibt die Heizkostenverordnung vor, dass in zentral beheizten Mehrfamilienhäusern die verbrauchsabhängige Abrechnung erfolgen muss. Dies hat an sich schon einen energiesparenden Effekt: Bewohner, die mehr heizen, zahlen mehr, wodurch ein Teil der Verschwendung vermieden wird. Neu ist die Anforderung, dass modernisierte Liegenschaften fernablesbare Zähler installieren müssen und den Mietern unterjährige Verbrauchsinformationen bereitstellen (z.B. monatliche Verbrauchsmitteilungen) – ein Werkzeug, um das Bewusstsein weiter zu schärfen. Das Facility Management kann darüber hinaus sogenannte Energieberatungen für Mieter anbieten. Einige Wohnungsunternehmen verschicken z.B. vor der Heizsaison Tippschreiben („Richtig heizen und lüften“) oder setzen Energiescouts ein, die bei hohen Verbräuchen individuelle Beratung anbieten. Zwar liegt das Verhalten letztlich beim Mieter, doch Studien zeigen, dass durch Feedback und Beratung Einsparungen von 5–10 % im Verbrauch möglich sind (Verhaltensenergieeffizienz).
Zentraler in der Hand des FM sind die Anlagentechnik und Wartung. In Wohnanlagen wird oft – anders als in Gewerbe – mit einfacheren Mitteln betrieben, z.B. keine durchgängige Gebäudeleittechnik, sondern thermostatische Ventile und Außenfühler. Umso wichtiger ist die regelmäßige Wartung der Heizung: jährliche Kesselinspektion, Brennereinstellung optimieren, Entlüftung der Heizkörper etc. Hier greift die Norm DIN EN 15378, die Inspektionsverfahren zur Beurteilung der Energieeffizienz von Heizungsanlagen festlegt. Ein Heizungscheck nach diesem Standard (oder gemäß vereinfachter „Heizungslabel“ Methode nach BAFA) sollte alle paar Jahre erfolgen. Seit 2020 fördert das BAFA sogar gezielt die „Heizungsoptimierung im Bestand“ als Einzelmaßnahme: Erstattet werden 15 % der Kosten u.a. für hydraulischen Abgleich, Pumpentausch, Rohrdämmung und Regelungstechnik. Viele Hausverwaltungen haben dieses Programm genutzt, um alte Heizungspumpen (Stromfresser) durch hocheffiziente Pumpen zu ersetzen oder Rohrleitungen in Kellern nachzudämmen – klassische KVP-Maßnahmen, die sofort Verbrauch senken. Pflicht ist bei solchen Maßnahmen die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs (wie oben erwähnt) und das Ausfüllen einer VdZ-Bestätigung durch einen Fachbetrieb, was sicherstellt, dass die Maßnahme mit der notwendigen Sorgfalt umgesetzt wird.
In Wohnanlagen ist ferner die Temperatursteuerung in Gemeinschaftsbereichen (Treppenhäuser, Flure) zu beachten: Oft werden diese unnötig beheizt. GEG fordert nur in Wohnungen eine Mindesttemperierbarkeit; gemeinschaftliche Flure können durchaus kühler gehalten oder zeitweise abgesenkt werden. Ein FM sollte prüfen, ob evtl. Heizkörper in Fluren gedrosselt oder mit Thermostat ausgestattet werden können. Auch Fenster und Türen (Dämmzustand, Dichtigkeit) sind ein Thema – defekte Schließer an Hauseingangstüren können Heizwärmeverluste drastisch erhöhen (ständiger Kaltlufteinfall). Solche Punkte fallen unter die Betreiberverantwortung: zügige Instandsetzung ist hier zugleich Energiesparmaßnahme. Organisatorisch sind Wohnanlagen insofern anders, als kein festes Nutzermanagement im Gebäude sitzt. Daher muss das FM regelmäßige Begehungen einplanen, z.B. im Winter einmal monatlich Kontrolle von Heizungsraum, Pumpeneinstellungen und vielleicht Stichproben in Wohnungen (mit Zustimmung) um Thermostate zu prüfen. Einige größere Wohnungsunternehmen arbeiten mit digitalen Zwillingen ihrer Liegenschaften und nutzen KI, um Sanierungs- und Optimierungsfahrpläne zu erstellen – dies ist KVP auf Portfolioebene. Im Tagesbetrieb aber sind oft die einfachen Dinge wirkungsvoll: eine engagierte Hausmeisterin, die die Anlage im Auge behält, ein gutes Beschwerdemanagement (damit Überhitzung gemeldet und nicht über Fenster gelöst wird) und die konsequente Umsetzung der kleinen Verbesserungen.
Zusammengefasst erfordert jeder Gebäudetyp eine angepasste Strategie: Im Krankenhaus mit 24/7-Betrieb stehen technische Feinsteuerung und Zuverlässigkeit im Vordergrund, Schulen brauchen klare Zeitprogramme und Nutzerengagement, Bürogebäude profitieren von Automationsoptimierung und Management-Aufmerksamkeit, während Wohnanlagen eine Mischung aus technischer Anlagenoptimierung und Mieterinformation erfordern. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess bietet für alle diese Fälle den Rahmen, systematisch vorzugehen und aus Erfahrungen zu lernen. Praxisbeispiele aus allen Bereichen zeigen, dass zweistellige prozentuale Einsparungen möglich sind, wenn technische und organisatorische Hebel kombiniert werden.
Integration von Rechtsnormen und Förderprogrammen
Bei allen Optimierungsmaßnahmen im Heizbetrieb müssen die geltenden Rechtsnormen, Standards und Förderbedingungen berücksichtigt werden. Deutschland verfügt über einen dichten Regulierungsrahmen im Gebäudebereich, der sowohl Mindestanforderungen vorgibt als auch Anreize für Effizienzverbesserungen setzt.
Eine erfolgreiche KVP-Strategie im Facility Management kennt diese Vorgaben und nutzt sie im Sinne der Betriebsoptimierung:
Gebäudeenergiegesetz (GEG): Das GEG ist die zentrale Rechtsnorm, welche energetische Standards für Gebäude definiert. Es fasst seit 2020 die frühere EnEV, das EEWärmeG und EnEG zusammen. Für den Betrieb von Heiztechnik relevant sind mehrere Aspekte: Zum einen schreibt das GEG technische Ausrüstungen vor, z. B. dass Zentralheizungen mit einer Regelung auszustatten sind, die eine zeit- und temperaturabhängige Steuerung erlaubt (Einzelraumregelung, Nachtabsenkung). Außerdem verpflichtet es Eigentümer, bestimmte Nachrüstungen vorzunehmen, etwa Dämmung ungedämmter Wärmeverteilungsrohre in unbeheizten Räumen (GEG §71) – eine einfache Maßnahme, die direkt Energie spart. Wichtig ist die Austauschpflicht für alte Heizkessel: Konstanttemperaturkessel >30 Jahre (bis Baujahr ca. 1990) dürfen nicht mehr betrieben werden, mit Ausnahmen nur für selbstnutzende Eigentümer kleiner Häuser. Diese Regel forcierte in den letzten Jahren einen Modernisierungsschub hin zu Brennwerttechnik oder alternativen Systemen. Das GEG fordert weiterhin die Ausstellung von Energieausweisen bei Verkauf/Vermietung und für öffentliche Gebäude, was indirekt Druck auf effiziente Betriebsführung ausübt – ein hoher Verbrauch würde im Ausweis sichtbar. Neuere Änderungen richten sich auf klimafreundlichere Heizungssysteme: Ab 2024 ff. plant der Gesetzgeber Anforderungen, dass neu eingebaute Heizungen möglichst 65 % erneuerbare Energie nutzen sollen. Für den laufenden Betrieb enthält das GEG auch die Pflicht zur regelmäßigen Heizungsinspektion (für zentrale Klimaanlagen und für Heizkessel >100 kW alle 4 Jahre, gemäß EU-Vorgaben). Hier kommt die Norm DIN EN 15378 ins Spiel, die Verfahren für diese Inspektionen bereitstellt. Auch wenn diese Inspektionen in der Praxis noch lückenhaft umgesetzt werden, bietet ihre konsequente Durchführung eine gute Grundlage für KVP: Ein daraus resultierender Bericht zeigt dem Betreiber Verbesserungsmöglichkeiten auf (z. B. höhere Brennwertnutzung, Dämmung, Austausch alter Thermostate). Das GEG verweist zudem auf DIN V 18599 als Rechenstandard zur Ermittlung der energetischen Qualität eines Gebäudes. Seit 2023 ist im Rahmen der BEG-Förderung die Bilanzierung einheitlich nach DIN V 18599 vorgeschrieben, und ab 2024 wird diese Vornorm auch für alle Wohngebäude im GEG verbindlich. Für den KVP bedeutet dies: Wer Sanierungsvarianten oder Betriebsoptimierungen energetisch bewerten will, sollte idealerweise mit DIN 18599-Berechnungen arbeiten (oder durch einen Energieberater arbeiten lassen), um belastbare Zahlen zu haben. Zusammengefasst gibt das GEG den Ordnungsrahmen vor – effiziente Technik und Betrieb sind nicht mehr freiwillig, sondern in weiten Teilen Pflicht. Ein FM-Leiter sollte diese Pflichten kennen, um sowohl Compliance sicherzustellen als auch mögliche Ausnahmen (z. B. Härtefallanträge) oder Übergangsfristen nutzen zu können.
DIN-Normen (DIN V 18599, DIN EN 15378 u.a.): Neben gesetzlichen Vorgaben spielen technische Normen und Richtlinien eine wichtige Rolle. DIN V 18599 (Energetische Bewertung von Gebäuden) ist mit ihren 13 Teilen der maßgebliche Standard, um den End- und Primärenergiebedarf eines Gebäudes zu berechnen. Für den KVP liefert diese Norm ein Werkzeug, um Szenarien zu simulieren – etwa wie sich ein hydraulischer Abgleich oder ein Pumpentausch auf den Jahresenergiebedarf auswirken würde. Energieberater nutzen diese Berechnungen, um Sanierungsvorschläge zu quantifizieren. Im Betrieb kann eine vereinfachte Methode (z. B. Gradtagverfahren) eingesetzt werden, um Einsparerfolge abzuschätzen, doch DIN 18599 bietet die detailliertere Grundlage. Die Norm wird auch im Rahmen von Energieaudits und ISO 50001-Systemen herangezogen, wenn die energetische Ausgangsbilanz eines Standorts erstellt wird. – DIN EN 15378 wiederum ist insbesondere für Bestandsanlagen relevant: Teil 1 der Norm legt Verfahren fest, um die Gesamtenergieeffizienz von vorhandenen Heizkesseln und Heizungsanlagen zu inspizieren und zu beurteilen. Sie implementiert damit die EU-Vorgabe regelmäßiger Heizungsüberprüfungen (EPBD-Richtlinie). Ein Heizungscheck nach DIN 15378 umfasst z.B. die Überprüfung der Kesselwirkungsgrade, der Auslegung der Anlage, der Regelungseinstellungen und des hydraulischen Abgleichs. Das Ergebnis ist oft ein Effizienzlabel (ähnlich dem von Elektrogeräten) für die Heizung sowie eine Liste empfohlener Maßnahmen zur Optimierung. Solche Checks sind ein niedrigschwelliges Mittel, um einen KVP-Impuls zu setzen – viele Hausbesitzer oder Betreiber werden erst durch einen systematischen Check auf konkrete Mängel aufmerksam. In Deutschland wurde 2017 eine vereinfachte Checkliste (nach DIN SPEC 15378-7, „Heizungscheck 2.0“) eingeführt, die Schornsteinfeger und Heizungsbauer nutzen können. Das FM sollte darauf achten, dass z.B. bei Wartungen diese Checks mit angeboten und dokumentiert werden. – DIN-Normen der Reihe 501xx und 16096 (Instandhaltung, Anlagenbetrieb) sowie VDI-Richtlinien (z.B. VDI 3810 Blatt 3 „Betreiben von Heizungsanlagen“ und VDI 3811 „Modernisierung von Heizungsanlagen“) geben weiteres fundiertes Wissen und Empfehlungen für KVP-Maßnahmen. So fordert VDI 3810 Blatt 3 explizit, dass der Betreiber die Anlagen nach anerkannten Regeln der Technik betreibt und instand hält, um Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten – was praktisch nur durch laufende Überprüfung und Optimierung erfüllbar ist. Der Verweis auf solche Normen im Wartungsvertrag oder Betreiberkonzept kann helfen, den KVP als Qualitätsstandard zu verankern.
EnSimiMaV (Mittelfrist-EnergiesicherungsmaßnahmenVO): Obwohl diese Verordnung zeitlich befristet war (Okt. 2022 bis Sept. 2024), ist sie als Beispiel für regulatorische Eingriffe in den Anlagenbetrieb bemerkenswert. Der Verordnungsgeber zielte hier hauptsächlich auf die Heizperioden ab und wollte kurzfristig Verbrauch senken. Zwei Kernpunkte waren: (1) Heizungsprüfung und -optimierung aller Erdgas-Heizungsanlagen bis zum 15. Sept. 2024, und (2) verpflichtender hydraulischer Abgleich in großen gasbeheizten Gebäuden (Termine 2023/2024 nach Gebäudegröße). Ersteres bedeutete, dass jeder Betreiber eine fachkundig durchgeführte Inspektion vornehmen musste – ausgenommen nur Anlagen, die nach dem 1. Oktober 2020 schon geprüft und für optimiert befunden wurden oder die in ein Energiemanagementsystem eingebunden sind. Dieser Ansatz spiegelt genau den KVP-Gedanken wider: regelmäßige Prüfung, Erkennen von Optimierungsbedarf, Umsetzung von Verbesserungen und Dokumentation derselben. Die Umsetzung war verpflichtend und wurde typischerweise von Schornsteinfegern oder Energieberatern aus der Energieeffizienz-Expertenliste durchgeführt. Die gefundenen Optimierungsmaßnahmen (z.B. Austausch Pumpe, Einstellung Brenner) mussten schriftlich dokumentiert und bis Mitte Sept. 2024 umgesetzt werden. – Der zweite Punkt, der hydraulische Abgleich, wurde schon im technischen Teil erläutert; hier wurde er per Verordnung zum Muss. Interessant sind die Ausnahmen von dieser Pflicht, die EnSimiMaV zuließ: nämlich wenn ohnehin in Kürze ein Heizungstausch oder eine größere Dämmung ansteht, oder das Gebäude bald stillgelegt wird. Dahinter steckt die ökonomische Abwägung: Wenn eine Anlage ohnehin ersetzt wird, macht ein Abgleich ggf. keinen Sinn mehr – ein Hinweis darauf, dass KVP-Maßnahmen stets im Kontext der Lebenszyklusplanung gesehen werden sollten (nicht jede Optimierung zu jedem Zeitpunkt ist effizient). – Weiterhin adressierte EnSimiMaV große Unternehmen (>10 GWh), wie oben erwähnt, mit der Pflicht, identifizierte wirtschaftliche Maßnahmen aus Audits umzusetzen. Die Prüf- und Nachweispflichten (Einsatz zertifizierter Auditoren, Bewertung nach DIN EN 17463) führten dazu, dass Energiemanagement in vielen Firmenchefetagen Aufmerksamkeit erlangte. Für das Facility Management bedeutete diese Verordnung einen erheblichen zusätzlichen Arbeitsaufwand in kurzer Frist – aber auch einen Schub, viele schlummernde Effizienzpotenziale endlich zu heben. Nach Außerkrafttreten der Verordnung (30. Sept. 2024) bleiben viele Maßnahmen dennoch wirksam. Die Politik hat signalisiert, dass ähnliche Anforderungen künftig ins Dauerrecht (GEG oder Folgeregelungen) einfließen könnten. FM-Verantwortliche sollten diese Entwicklung wachsam verfolgen, um frühzeitig vorbereitet zu sein. EnSimiMaV hat gezeigt, dass Compliance und KVP Hand in Hand gehen: Was früher freiwillig war, wurde zur Pflicht – wer also proaktiv optimiert, hat bei solchen Vorgaben später weniger Stress und meist die wirtschaftlichsten Verbesserungen bereits realisiert.
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG): Die BEG ist das zentrale Förderinstrument des Bundes, um Energieeffizienz und erneuerbare Energien in Gebäuden voranzubringen. Sie umfasst sowohl Effizienzhaus-Sanierungen als auch Einzelmaßnahmen. Für das Facility Management sind insbesondere die Fördertatbestände relevant, die betriebstechnische Optimierungen betreffen. Hierzu zählt vor allem das Programm „Heizungsoptimierung“, welches bereits seit 2016 (damals noch außerhalb BEG) besteht und nun unter BEG-Einzelmaßnahmen weitergeführt wird. Gefördert werden „sämtliche Maßnahmen zur Optimierung von Heizungsanlagen in Bestandsgebäuden“, sofern der Wärmeerzeuger älter als 2 Jahre ist. Genannt werden explizit: hydraulischer Abgleich, Austausch oder Regelung von Pumpen, Anpassung der Vorlauftemperaturen, Rohrleitungsdämmung, Einbau von Flächenheizungen oder Pufferspeichern zur Rücklaufabsenkung, sowie Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Die Liste entspricht genau den typischen KVP-Maßnahmen im Heizbetrieb. Die Förderung beträgt 15 % Zuschuss auf die Investitionskosten (Mindestinvestition 300 €). Wichtig ist die Voraussetzung: Es muss ein hydraulischer Abgleich nach Verfahren B durchgeführt und durch Fachunternehmer bestätigt werden – dies stellt sicher, dass nicht isolierte Einzelaktionen stattfinden, sondern die Anlage gesamthaft optimiert wird. Für Wohngebäude wird diese Förderung sehr stark genutzt (tausende Anträge auf Pumpentausch & Abgleich), aber auch Nichtwohngebäude können sie in Anspruch nehmen (allerdings begrenzt auf 1.000 m² beheizte Fläche pro Antrag). Für das FM bedeutet das: Wann immer Optimierungen anstehen, sollte geprüft werden, ob BEG-Fördermittel verfügbar sind – sie reduzieren die Amortisationszeit deutlich und können helfen, interne Investitionsentscheidungen zu erleichtern. Neben der Heizungsoptimierung fördert die BEG natürlich größere Maßnahmen wie den Heizungstausch (z.B. Gas- oder Ölkessel raus, Wärmepumpe rein) mit deutlich höheren Zuschüssen. Bei solchen Projekten ist es unabdingbar, auch gleich die Betriebsoptimierung mitzudenken: Förderprogramme verlangen u.a., dass Wärmeverteilsysteme angepasst werden (z.B. Heizkörper geeignet für Wärmepumpenbetrieb) und ein dauerhafter Effizienznachweis durch Fachplanung/Baubegleitung erfolgt. Somit tragen Förderbedingungen indirekt zum KVP bei, indem sie Qualitätssicherung vorschreiben (Energie-Effizienz-Experten müssen die Maßnahmen bestätigen). Ein weiteres wichtiges Förderfeld ist die Bundesförderung für Energieberatung für Nichtwohngebäude, wo ein Energieberater Einsparmaßnahmen aufzeigt – oft ein erster Schritt in den KVP, gefördert mit 80 % der Beratungskosten.
Zusätzlich zu BEG gibt es branchenspezifische Programme (z.B. für Krankenhäuser oder KMU), aber im Kern lassen sich viele Optimierungsvorhaben zumindest teilweise öffentlich fördern. Ein professionelles Facility Management behält diese Möglichkeiten im Blick und kalkuliert sie ein. Allerdings muss man die administrativen Anforderungen berücksichtigen: Förderanträge erfordern Vorher-Nachher-Nachweise, Einsatz zertifizierter Experten und Einhaltung technischer Mindestanforderungen. Das kann durchaus den KVP strukturieren – z.B. zwingt es zu einer sauberen Dokumentation der Ausgangssituation (Fotos, Protokolle), klaren Spezifikationen der Maßnahme und einer Erfolgskontrolle hinterher. All dies deckt sich mit dem Gedanken des kontinuierlichen Verbesserungszyklus.
Abschließend sei erwähnt, dass jenseits von Energiegesetzen auch allgemeine Betreiberpflichten einen Rahmen setzen. So verlangt etwa die Arbeitsstättenverordnung, dass in Arbeitsräumen ein gesundes Raumklima herrscht – was im Umkehrschluss aber auch heißt, nicht überheizen (max. 20–22 °C empfohlen). VDI 3810 zur Instandhaltung fordert die Beachtung von Umweltschutz und Energieeffizienz gleichrangig mit Sicherheit. Und GEFMA 124 (Energie- und Umweltmanagement im FM) gibt Hinweise, wie Energiemanagement organisatorisch zu verankern ist. Diese Regelwerke untermauern, dass die Optimierung der Heiztechnik kein „Nice-to-have“, sondern integraler Bestandteil eines rechtssicheren, professionellen Gebäudebetriebs ist.
