Technische Planunterlagen für Heizsysteme
Facility Management: Heiztechnik » Strategie » Ausführungsplanung » Leistungsphase 5 der HOAI
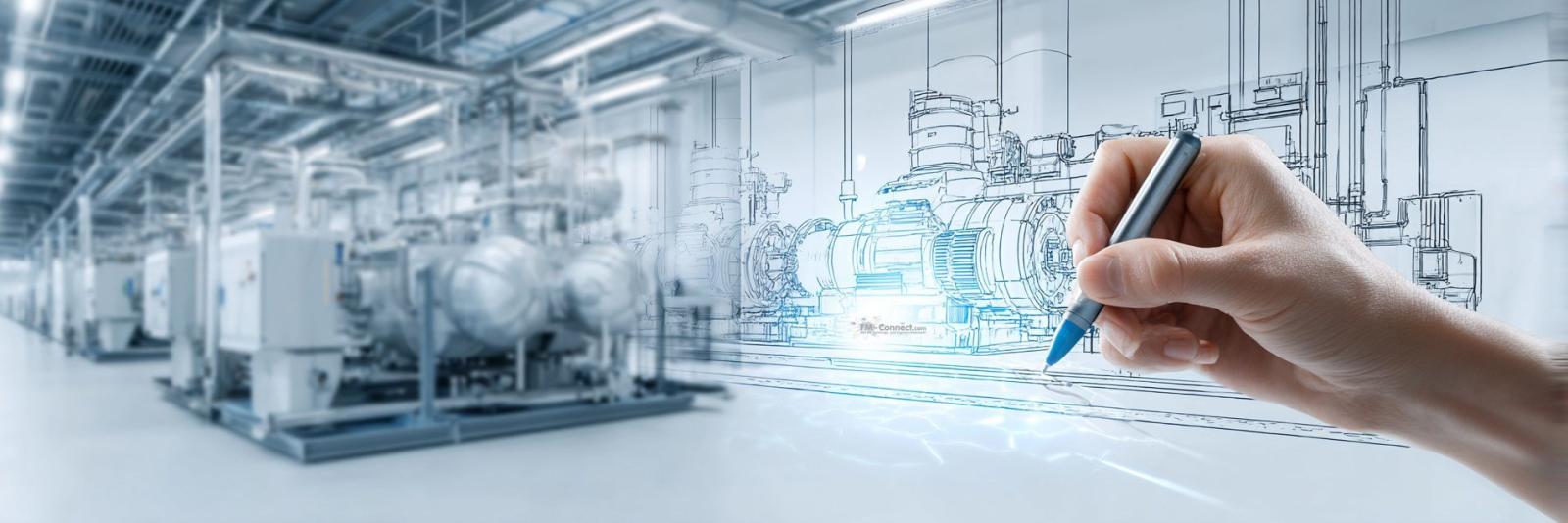
Funktionale Prüfanweisung Heiztechnik: Ausführungsplanung
Diese Prüfanweisung beschreibt die methodische, funktionale Prüfung der Ausführungsplanung für die Heiztechnik eines neu zu errichtenden Industriekomplexes mit Verwaltungs- und Produktionsgebäuden (Bürotrakte, Werkshallen, Werkstätten, Lager). Sie dient dazu, im Rahmen der Leistungsphase 5 HOAI (Ausführungsplanung) sicherzustellen, dass die geplante Heizungsanlage technisch einwandfrei, gesetzeskonform und betrieblich geeignet ist, bevor eine Freigabe zur Realisierung erteilt wird. Die Ausführungsplanung ist die letzte Planungsstufe vor der Ausführung und muss alle strategischen Vorgaben des Bauherrn sowie Anforderungen des Facility Managements (FM) in klare technische Unterlagen überführen In dieser Phase werden sämtliche Details der Heiztechnik festgelegt – von der Auswahl der Wärmeerzeuger über die Auslegung von Rohrleitungen und Wärmeübergabestationen bis zur Platzierung einzelner Heizflächen. Fehler oder Lücken in der Planung können zu kostspieligen Änderungen während des Baus, ineffizientem Betrieb oder gar Gefährdungen führen. Daher ist eine sorgfältige fachtechnische Prüfung unerlässlich, die sowohl die Konformität mit Gesetzen und Normen als auch die praktische Umsetzbarkeit und Funktionalität sicherstellt.
Die unterschiedlichen Nutzungen stellen heterogene Anforderungen an die Beheizung: In Büros sind etwa konstante komfortable Raumtemperaturen erforderlich, während in Hallen die Wärme gleichmäßig in großen Volumen verteilt werden muss. Zudem können Bereiche mit speziellen Erfordernissen existieren (z. B. frostfreie Lager, heiztechnisch versorgte Lüftungsanlagen für Werkstätten, ggf. Klimaanforderungen in bestimmten Produktionsprozessen). Die Heiztechnikplanung muss daher ein integriertes Konzept liefern, das all diesen Bedürfnissen gerecht wird, ohne die Gesamtwirtschaftlichkeit und Energieeffizienz des Neubaus zu gefährden. Durch die Prüfung soll sichergestellt werden, dass die Heizungsanlage funktional, sicher und energieeffizient geplant ist. Nur eine einwandfreie Ausführungsplanung kann in die Bauausführung übergehen. Eventuelle Korrekturen, die sich aus der Prüfung ergeben, sind vom Fachplaner umzusetzen, bevor die finale Freigabe erfolgt. Dies entspricht dem Grundsatz, dass Ausführungsplanung ein wesentliches Bindeglied zwischen Planung und Betrieb ist und daher höchste Sorgfalt verdient.
Für den Bauherrn und das Facility Management entsteht durch diese Prüfung ein hohes Maß an Transparenz und Sicherheit. Langfristig werden so Risiken von Fehlplanungen reduziert, was wiederum Betriebskosten senkt und Ausfallrisiken minimiert. Die Berücksichtigung von FM-Belangen schon in der Planungsphase – wie hier praktiziert – stellt einen Mehrwert dar, der im späteren Betrieb durch reibungslose Funktion und Wartungsfreundlichkeit sichtbar wird.
Ziel der Prüfanweisung
Die vorliegende Prüfanleitung richtet sich an Prüfverantwortliche im Facility Management sowie an Qualitätsprüfer der technischen Gebäudeausrüstung. Sie soll als Leitfaden dienen, um die vollständige Ausführungsplanung der Heizungsanlage systematisch zu kontrollieren.
Dabei werden unter anderem folgende Aspekte behandelt:
Vollständigkeit und Schlüssigkeit der Planunterlagen (Pläne, Schemata, Berechnungen, Anlagendaten),
Übereinstimmung mit gesetzlichen Vorschriften (Gebäudeenergiegesetz – GEG, etc.) und anerkannten Normen (DIN/VDI/VDE-Regelwerk),
Technische Konsistenz der Auslegung (Heizlastberechnung, Rohrnetzdimensionierung, hydraulische Schemata, Regelstrategie),
Berücksichtigung von Betriebs- und Wartungsaspekten (Zugänglichkeit, Redundanzen, Instandhaltungskonzepte, FM-Strategie) bereits in der Planung,
Sicherheits- und Automationsanforderungen, insbesondere Integration in die Gebäudeleittechnik (GA) und Einhaltung aller relevanten Schutzvorschriften.
Als Ergebnis der Prüfung soll festgestellt werden, ob die Heizungsplanung freigegeben werden kann – ggf. mit Auflagen oder Korrekturen – oder ob Nachbesserungsbedarf besteht. Eine strukturierte Prüftabelle (Checkliste) am Ende dieser Ausarbeitung fasst die Prüfpunkte übersichtlich zusammen, sodass sie direkt bei der Planprüfung abgehakt und dokumentiert werden können.
Rechtliche und normative Rahmenbedingungen
Die Heizungsplanung eines Neubaus unterliegt in Deutschland vielfältigen gesetzlichen Vorgaben und technischen Normen. Die Ausführungsplanung muss zwingend alle einschlägigen Gesetze, Verordnungen und technischen Regeln einhalten. Im Folgenden werden die wichtigsten Anforderungen und deren Bedeutungen für dieses Projekt zusammengefasst.
Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist das zentrale Regelwerk für energetische Anforderungen an Gebäude und Anlagentechnik. Für Neubauten – ob Wohn- oder Nichtwohngebäude – schreibt das GEG strenge Effizienzstandards und den Einsatz erneuerbarer Energien vor. Aktuell (Stand 2024) gilt insbesondere die „65 %‑Regel“, wonach jede neu eingebaute Heizung einen Anteil von mindestens 65 % erneuerbarer Energien an der bereitzustellenden Wärme aufweisen muss. Diese Vorgabe ist in Neubaugebieten ab dem 1. Januar 2024 sofort verbindlich, für andere Neubauten gelten gestaffelte Übergangsfristen bis spätestens 2028. Praktisch bedeutet dies, dass reine fossile Heizkessel (Gas- oder Öl) im Regelfall nicht mehr zulässig sind, es sei denn in Hybridlösungen (z. B. Gas-Brennwertkessel in Kombination mit einer Wärmepumpe oder Solarthermie) oder beim Einsatz von grünen Gasen/Biobrennstoffen.
Für die Ausführungsplanung ist daher zu prüfen, ob das geplante Heizsystem die GEG-Vorgaben erfüllt. Im konkreten Projekt könnte dies z. B. durch den Einsatz einer Wärmepumpe oder den Anschluss an ein Fernwärmenetz mit überwiegend erneuerbarer Erzeugung geschehen. Alternativ käme ein Gas-Brennwertkessel nur in Frage, wenn er Teil eines Hybridsystems ist (etwa in Ergänzung mit Solarthermie oder einer elektrischen Wärmepumpe), das zusammen die 65 %-EE-Anforderung erfüllt. Die Prüfer müssen die dazugehörigen Nachweise verlangen, etwa eine GEG-Nachweisrechnung (Primärenergiebedarf des Gebäudes) und gegebenenfalls Bescheinigungen über den EE-Anteil (z. B. Fernwärme-Qualität oder Auslegung der Wärmepumpe). Sofern das Gebäude als Nichtwohngebäude besonderen Nutzungen unterliegt, sind auch eventuelle Ausnahmen oder spezielle Rechenverfahren nach GEG zu beachten – hier ist jedoch im Regelfall keine Befreiung von der 65 %-Regel vorgesehen, da auch Industrie-/Gewerbebauten dieser Pflicht unterliegen.
Über die 65 %-Regel hinaus fordert das GEG u. a. die Einhaltung eines maximalen Primärenergiebedarfs und bestimmter Dämmstandards. Für die Heiztechnik bedeutet dies: hoch effiziente Wärmeerzeuger (Brennwerttechnik, Wärmepumpen mit hoher Leistungszahl etc.), geringe Verteilverluste (gedämmte Leitungen, hydraulischer Abgleich) und intelligente Regelungen. All dies wird in der Prüfung thematisiert. Beispiel: Die Planer müssen nachweisen, dass die Rohrleitungsdämmungen den Anforderungen des GEG entsprechen und dass die Anlagentechnik so ausgelegt ist, dass keine unnötigen Wärmeverluste auftreten. Hierzu können Normangaben aus dem GEG herangezogen werden (z. B. Tabellen für Mindestdämmstärken) – ein Abgleich der Planungsunterlagen mit diesen Vorgaben ist vorzunehmen.
DIN EN 12831 (Heizlastberechnung)
Die Norm DIN EN 12831 (inkl. nationaler Ergänzungen) regelt das Verfahren zur Berechnung der Heizlast von Gebäuden. Die Heizlast ist die thermische Leistung, die benötigt wird, um die gewünschte Innenraumtemperatur bei einer definierten Außentemperatur (Norm-Außentemperatur) aufrechtzuerhalten. Im Rahmen der Ausführungsplanung muss eine vollständige Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 vorliegen, die für alle Räume/Gebäudebereiche die erforderlichen Wärmeleistungen ausweist. Diese Berechnung ist Grundlage für die Auslegung der Wärmeerzeuger, Wärmeübertrager (Heizflächen) und der Regelung.
Bei der Prüfung ist sicherzustellen, dass die Heizlastberechnung plausibel und vollständig ist. Plausibilitätskriterien sind etwa: Sind die geometrischen Daten und U-Werte der Gebäudehülle konsistent mit den Architekturangaben? Wurden realistische Nutzungsbedingungen angenommen (Raum-Solltemperaturen gemäß Gebäudefunktion, z. B. Büro 20 °C, Lager ggf. 12–15 °C, Werkstatt/Halle ~17 °C)? Entsprechen die ansetzbaren internen Wärmegewinne und Lüftungswärmeverluste den tatsächlichen Planungen (z. B. Berücksichtigung von Maschinenabwärme oder erforderlichem Mindestluftwechsel)? Die Norm gibt hier klare methodische Schritte vor, die einzuhalten sind. Teil 1 der DIN EN 12831 behandelt die Raumheizlast, während Teil 3 (vormals DIN EN 15316-3-1) die Heizlast für die Trinkwassererwärmung regelt. Für unseren Zweck ist vorrangig die Raumheizlast relevant, da die Warmwasserbereitung in einem Industriebau eher untergeordnet ist (auf Warmwasserbedarfe in Sanitärbereichen wird dennoch zu achten sein).
Die Prüfer werden kontrollieren, ob die Summe der Raumheizlasten mit der Anlagenauslegung übereinstimmt. Insbesondere: Die ausgewählte Kesselleistung/Wärmepumpenleistung plus eventuelle Reserven sollte zur berechneten Gebäude-Heizlast passen. Ist auffällig, dass die Heizleistung erheblich über der berechneten Last liegt (Überdimensionierung) oder darunter (Risiko der Unterversorgung), muss die Planung infrage gestellt werden. Gemäß DIN EN 12831 sollen auch Sicherheitszuschläge nur in definiertem Maß erfolgen (typisch werden z. B. 10 % Zuschlag auf die gesamte Heizlast empfohlen, falls nötig, um Unsicherheiten zu berücksichtigen). Unverhältnismäßige Überdimensionierungen sind unwirtschaftlich und können zu ineffizientem Betrieb führen (z. B. Takten von Kesseln). Die Prüfanweisung verlangt daher, dass im Prüfprotokoll vermerkt wird, wie die Dimensionierung der Wärmeerzeuger zur Norm-Heizlast steht.
DIN EN 14336 (Installation und Abnahme von Warmwasser-Heizungsanlagen)
Die Norm DIN EN 14336 legt Anforderungen an die Inbetriebnahme, Prüfung und Abnahme von Warmwasserheizungsanlagen fest. Sie richtet sich zwar primär an die Ausführungs- und Abnahmephase, hat aber auch Auswirkungen auf die Planung: Schon in der Ausführungsplanung muss berücksichtigt werden, dass bestimmte Prüfungen und Prozeduren technisch möglich und vorgesehen sind. Beispielsweise fordert DIN EN 14336, dass Heizungsanlagen vor Inbetriebnahme ordnungsgemäß gespült und auf Dichtheit geprüft werden. Die Planung muss daher Spüleinrichtungen (z. B. Anschlüsse an tiefsten Punkten) vorsehen, die es ermöglichen, Luft und Schmutz vor Betrieb aus dem System zu entfernen.
Ein zentraler Punkt ist die Druckprüfung der Anlage. Nach VOB/C ATV DIN 18380 (siehe unten) muss die Dichtheitsprüfung mindestens mit dem Ansprechdruck des Sicherheitsventils erfolgen, i.d.R. also ca. 2,5–3 bar bei Gebäudestandardsicherheitsventilen. DIN EN 14336 geht hier sogar weiter und empfiehlt eine Prüfung mit dem 1,3-fachen Betriebsdruck. In der Praxis wird beides oft kombiniert: Zunächst eine Vorprüfung mit erhöhtem Druck (um z.B. Montagefehler aufzudecken) und schließlich eine Endprüfung auf Betriebsdruckniveau. Für die Planungsprüfung heißt das: Es ist zu kontrollieren, ob die Anlage (inkl. aller Komponenten) für diese Prüfdrucke ausgelegt ist. Beispielsweise müssen Membranausdehnungsgefäße (MAG) während der Druckprobe abgesperrt werden können und Sicherheitsventile ggf. durch Blindstopfen ersetzt oder überbrückt werden, damit sie nicht frühzeitig auslösen. Die Ausführungsplanung sollte entsprechende Hinweise im Schema oder in der Leistungsbeschreibung enthalten (z.B. “Vor Inbetriebnahme Druckprobe mit x bar, MAG absperren, SV schließen” etc.). Der Prüfer achtet darauf, dass solche Aspekte nicht übersehen wurden.
Weiterhin verlangt DIN EN 14336 eine vollständige Dokumentation der Inbetriebnahme (Prüfprotokolle, Abnahmeberichte) sowie die Einstellung aller Regel- und Steuereinrichtungen auf die vorgegebenen Sollwerte. Dies fließt zwar erst bei Inbetriebnahme selbst ein, doch die Planung muss sicherstellen, dass z.B. Regelventile zugänglich sind und Messstellen für Temperaturen/Drucke vorgesehen sind, um diese Prüfungen durchführen zu können. Im Rahmen der Ausführungsplan-Prüfung wird daher kontrolliert, ob ausreichend Messstutzen, Manometer, Thermometer etc. in den Plänen eingezeichnet bzw. in der Stückliste aufgeführt sind, damit die vorgeschriebenen Messungen (Durchfluss, Temperatur, Druck) bei der Abnahme möglich sind. Fehlen solche Mess- und Entlüftungsmöglichkeiten, wäre dies ein Planungsfehler, der zu Beanstandungen führt.
VDI-Richtlinie 2035 (Vermeidung von Schäden durch Wasserqualität)
Die VDI 2035 ist eine der bedeutendsten technischen Richtlinien in der Heiztechnik, da sie den Stand der Technik für die Wasserqualität in Warmwasser-Heizungsanlagen beschreibt. Ziel der Richtlinie ist es, Schäden durch Steinbildung (Kalkablagerungen) und Korrosion in Heizungsanlagen zu vermeiden. Obwohl die VDI 2035 selbst kein Gesetz ist, wird sie von Normen und Verträgen regelmäßig referenziert und gilt damit als allgemein anerkannte Regel der Technik. So verweist etwa die Planungsnorm DIN EN 12828 explizit auf die Anforderungen der VDI 2035 bezüglich Heizungswasser. In Werkverträgen nach VOB wird die Einhaltung der VDI 2035 ebenfalls meist geschuldet sein, da Abweichungen davon als Mangel gewertet würden.
Für die Ausführungsplanung bedeutet dies: Es muss ein Wasserbeschaffenheits-Konzept vorliegen. Der Planer hat festzulegen, ob und wie das Füll- und Ergänzungswasser der Heizungsanlage behandelt werden muss, um den VDI-Grenzwerten zu genügen. Typische Parameter sind Gesamthärte, pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit und Sauerstoffgehalt. Die VDI 2035 (Blatt 1, Neuausgabe 2021) gibt z.B. folgende Empfehlungen: möglichst enthärtetes oder demineralisiertes Wasser verwenden, um Kalkbildung zu verhindern, insbesondere bei großen Anlagenvolumina oder sehr hartem Speisewasser. Für die Korrosionsvermeidung (ehemals Blatt 2, jetzt in Blatt 1 integriert) wird ein bestimmter pH-Bereich empfohlen (meist 8,2–10, bei Aluminium-Komponenten nur bis pH 9), sowie die Minimierung von Sauerstoffeintrag. Nachweis in der Planung: Der Prüfer sucht im Heizungsanlagenkonzept Angaben wie „Füllwasser nach VDI 2035 behandeln“, „Enthärtungsanlage vorgesehen“ oder „Demineralisierungskartusche beim Befüllen einsetzen“. Gegebenenfalls müssen Berechnungen zur Karbonathärte vorgelegt werden, insbesondere wenn das Anlagenvolumen groß ist (z.B. weiträumiges Hallennetz mit vielen hundert Litern Wasser).
Auch konstruktive Aspekte spielen herein: Sollte das System direkt an Fernwärme angeschlossen sein (also ohne Wärmetauscher), kann der Betreiber kaum eigene Wasseraufbereitung nutzen, da das Fernwärmewasser vorgegeben ist. In diesem Fall muss die Planung sicherstellen, dass das verwendete Fernwärmewasser die Anforderungen erfüllt oder es müssen mit dem Versorger entsprechende Vereinbarungen bestehen. In indirekten Systemen (mit Wärmetauscher) hingegen kann der Betreiber des Hausnetzes eigenständig Inhibitoren oder Aufbereitungsverfahren einsetzen. Die Prüfanweisung verlangt, dass solche Unterschiede erkannt und dokumentiert werden: Direktanschluss Fernwärme ⇒ VDI 2035 nicht vollumfänglich umsetzbar durch Betreiber (hier sollte zumindest in den Vertragsbedingungen mit dem FVU geklärt sein, welche Wasserqualität geliefert wird); mit eigenem Kessel/Wärmepumpe ⇒ Plan enthält Vorgaben für Füllwasserqualität (z.B. „GH < 0,1 mol/m³“ o. ä.).
Zusammengefasst: Die Prüfung betrachtet VDI 2035-Konformität als Kriterium der technischen Qualität. Fehlt ein Konzept zur Wasserqualität, ist dies ein erheblicher Mangel, da langfristig Anlagenstörungen (Kesselstein, Pumpenausfälle, Rohrkorrosion) drohen. Idealerweise ist in der Ausführungsplanung auch ein Wartungshinweis vermerkt, dass z.B. regelmäßig die Wasserbeschaffenheit kontrolliert werden muss (im Sinne des FM).
VDI-Richtlinie 3814 (Gebäudeautomation in der TGA)
Die VDI 3814 (Gebäudeautomation) ist eine umfangreiche Richtlinienreihe, die Planung, Ausführung und Betrieb der Gebäude- und Anlagenautomation regelt. Sie setzt die früheren VDI 3813 fort und berücksichtigt aktuelle Entwicklungen wie offene Kommunikationsprotokolle, IT-Sicherheit und Energieeffizienz in der Automation. Für die Heiztechnik bedeutet VDI 3814, dass bereits in der Planung Automationsfunktionen und Schnittstellen eindeutig definiert werden müssen. So fordert es auch die HOAI: Alle technischen Anlagen sind integraler Bestandteil der Gebäudeautomation zu betrachten. Normativ wird dies untermauert durch die DIN EN 15232 (Energetische Bewertung der Gebäudeautomation), welche angibt, welche Einsparpotenziale durch GA erreichbar sind und wie Anlagen zu klassifizieren sind.
In der Prüfpraxis wird kontrolliert, ob der Plan folgende Punkte berücksichtigt:
Regelstrategie und Automationsschema: Ist ein Steuerungs- und Regelungsdiagramm vorhanden (MSR-Schema), das die Funktionsabläufe der Heizungsanlage zeigt? Werden dort die Fühler, Aktoren, Regler und deren Wirkungsweise dargestellt? Die Prüfanweisung verlangt ein solches Schema zur Beurteilung. Fehlt es, muss es nachgereicht werden.
Automationsstation/GLT-Anbindung: Gibt es Angaben zur DDC (Direct Digital Control) oder GLT-Schnittstelle? Beispielsweise, ob die Heizungsanlage an eine zentrale Gebäudeleittechnik angebunden wird (etwa über BACnet, Modbus oder KNX). Nach VDI 3814 sollte klar sein, welche Datenpunkte überwacht und welche Befehle ferngesteuert werden können. Der Prüfer sucht nach Listen der Datenpunkte oder Formulierungen im Plantext wie „Aufschaltung der Heizungsanlagenmeldungen auf die GLT“.
Automationsfunktionen: Sind alle wesentlichen Funktionen vorgesehen, etwa: Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung, zeitgesteuerte Absenkbetriebe für Bürobereiche, Temperaturbegrenzungen (z. B. max. Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung), Pumpensteuerung (differenzdruckgeregelt mit Frequenzumrichter) etc.? Diese Funktionen sollten in den Planungsunterlagen beschrieben sein, ggf. in Form einer Funktionsbeschreibung oder als Anmerkungen im Schema. Die VDI 3814 fordert eine klare Zuordnung von Funktionen zu Automationsschemen und Verantwortlichkeiten.
GA-spezifische Anforderungen an Komponenten: Z.B., ob Ventilantriebe und Pumpen mit den notwendigen Stellsignalen / Rückmeldungen ausgerüstet sind (0‑10 V Stellgrößen, binäre Störmeldungen etc.). Auch, ob Messstellen (Temperatur, Druck, Durchfluss) an GA-fähige Sensoren gedacht wurde, die ins Leitsystem eingebunden werden können. All dies fließt in die Prüfung ein.
Die Prüfanweisung betont, dass Gebäudeautomation kein nachträglich drangefügtes Element sein darf, sondern von Anfang an integraler Bestandteil der Planung ist. Insbesondere im industriellen Umfeld ist es wichtig, einen zuverlässigen, energieoptimierten Betrieb zu gewährleisten, was ohne GA kaum möglich ist. Daher wird jede Diskrepanz zwischen heiztechnischer Planung und GA-Konzept beanstandet. Ein Beispiel: Falls die Heizkreisverteiler zwar korrekt hydraulisch dargestellt sind, aber kein Hinweis auf die Ansteuerung (z. B. motorische Mischer, Außentemperaturfühler, Raumregler) vorhanden ist, würde das als unzureichend bewertet. Ggf. muss der Planer dann nachliefern, wie die Regelung umgesetzt wird.
VOB/C – ATV DIN 18380 (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen Heizanlagen)
Bei öffentlichen Bauvorhaben und häufig auch bei privaten Projekten gelten die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Teil C als Vertragsgrundlage. Die ATV DIN 18380 konkretisiert die geschuldeten Leistungen und Ausführungsstandards für Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen. Für die Planung bedeutet dies, dass die ausgeschriebenen Leistungen den Vorgaben dieser Norm entsprechen müssen.
Die Prüfanweisung berücksichtigt die DIN 18380 in zweifacher Hinsicht:
Umfang der vorgesehenen Leistungen: DIN 18380 definiert z.B., welche Leistungen als Nebenleistungen ohne besondere Erwähnung geschuldet sind. Daraus ergibt sich, dass die Planung solche Leistungen nicht “vergessen” darf. Ein typisches Beispiel ist die bereits erwähnte Dichtheitsprüfung der Anlage, die laut DIN 18380 eine Nebenleistung darstellt und daher vom Auftragnehmer durchzuführen ist. Der Planer muss also keine separate Position dafür ausschreiben, aber die Anlage so planen, dass sie prüfbar ist (siehe oben bei DIN EN 14336). Gleiches gilt für das Spülen und Entlüften: Auch dies ist nach VOB eine Nebenleistung, aber der Erfolg muss möglich sein – d.h. z.B. Entlüftungsventile an höchster Stelle vorsehen.
Technische Ausführung und Material: Die Norm enthält Anforderungen etwa an Rohrverbindungen, Druckprüfung, Isolierung usw. So schreibt DIN 18380 vor, dass sämtliche Teile dicht zu montieren sind und bestimmte Prüfdrucke aushalten müssen (mind. Betriebdruck bzw. Ansprechdruck SV). Sie verlangt ferner die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik, worunter VDI 2035, DIN 12831 etc. fallen. In der Prüfung wird daher geschaut, ob irgendwo von diesen Standards abgewichen werden soll. Beispiel: Wenn der Planer ein neuartiges Kunststoffrohrsystem für eine Hallenheizung vorsieht, das möglicherweise nicht gängig ist, muss geprüft werden, ob dessen Verwendung im Rahmen von DIN 18380 statthaft ist. DIN 18380 gilt für Warmwasser-Heizungsanlagen mit zentraler Wärmeerzeugung – also genau unser Fall –, und definiert was unter fachgerechter Ausführung zu verstehen ist.
Die Prüfer können auch checken, ob in der Leistungsbeschreibung textlich auf DIN 18380 Bezug genommen wird (üblich ist z.B. der Passus: “Die Ausführung hat nach den anerkannten Regeln der Technik, den DIN-Vorschriften, insbesondere DIN 18380 etc. zu erfolgen.”). Fehlt ein solcher Verweis, besteht die Gefahr von Auslegungsschwierigkeiten im Vertrag; es sollte angemahnt werden, dies zu ergänzen.
Zusammengefasst: Gesetze und Normen bilden den Rahmen, innerhalb dessen sich die Heizungsplanung bewegen muss. Die Prüfanweisung verlangt den Abgleich der Planung mit diesen Vorgaben. Abweichungen oder fehlende Berücksichtigung werden als Mangel gewertet und müssen vor Freigabe der Planung behoben werden. Im Zweifel gilt: Im Kollisionsfall hat die strengere Vorschrift Vorrang – häufig also die gesetzliche Forderung (GEG) vor einer technischen Richtlinie. Idealerweise aber widersprechen sich seriöse Normen nicht, sondern ergänzen sich, sodass eine rechtskonforme und technisch einwandfreie Planung möglich ist.
Überblick der heiztechnischen Anlagensysteme
Bevor auf die spezifischen Prüfkriterien eingegangen wird, soll ein kurzer Überblick über die Heiztechniksysteme gegeben werden, die im vorliegenden Projekt zum Einsatz kommen oder kommen könnten. Das Verständnis der Systemarchitektur ist wichtig für die Ableitung der Prüfpunkte.
Im Neubau mit gemischter Nutzung (Verwaltung/Produktion) sind typischerweise folgende Hauptkomponenten einer Heizungsanlage vorhanden:
Zentrale Wärmeerzeugung: Ein zentraler Heizraum (Kesselhaus) oder eine Übergabestation versorgt sämtliche Gebäudeteile mit Heizwärme.
Als Energiequelle kommen hier in Frage:
Gas-Heizkessel (meist moderne Brennwertkessel, evtl. als Kaskade mehrerer Geräte),
Fernwärme (Anschluss an ein externes Heizkraftwerk-Netz über eine Hausstation),
Wärmepumpe (elektrisch betrieben, nutzt Umweltwärme aus Luft, Erde oder Wasser),
oder Kombinationslösungen (Hybridheizung, z. B. Gas plus Wärmepumpe, eventuell ergänzt um Solarthermie).
Wärmeverteilungssystem: Von der Erzeugung aus wird das Heizwasser über Pumpen und Rohrleitungen zu den einzelnen Bereichen geführt. Wichtige Bestandteile sind Pufferspeicher (Speicher für Heizwasser zur Entkopplung von Erzeuger und Verbrauchern, sofern notwendig), Heizkreisverteiler und Übergabestationen.
Übergabestationen können hier zwei Bedeutungen haben:
Zum einen die Fernwärme-Übergabestation im Hausanschlussraum (falls Fernwärme genutzt wird), die das Versorgungsnetz vom internen Netz trennt.
Zum anderen interne Übergabepunkte zwischen Hauptverteilung und Unterverteilungen (z. B. könnte jedes Hallenschiff eine eigene Unterstation mit Mischer und Pumpe haben).
Wärmeabgabesysteme: In den Räumen und Hallen erfolgt die eigentliche Heizwärmeabgabe über Heizflächen. Je nach Bereich sind dies z. B. Radiatoren/Konvektoren in Büros und Sozialräumen, Flächenheizungen (Fußbodenheizung) in Büros oder Sanitärbereichen, Deckenstrahlplatten in hohen Hallen oder Lufterhitzer (Warmluftgebläse) in Werkstätten und Lagern. Mitunter werden auch Lüftungsanlagen mit Heizregister zur Beheizung genutzt (z. B. in einer Lackierhalle), was aber hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt sei.
Regelungs- und Steuerungseinrichtungen: Jeder Heizkreis hat typischerweise eigene Regelventile (z. B. 3-Wege-Mischer) und Temperaturfühler. Pumpen können mit Frequenzumrichtern drehzahlgeregelt sein. Zentral gibt es eine Heizungssteuerung (Kesselsteuerung, Wärmepumpenregler oder DDC-Station), die den Betrieb nach Außentemperatur und Zeitplan optimiert. Diese Steuerung sollte in die Gebäudeleittechnik integriert sein (siehe VDI 3814 Aspekt oben).
Sicherheitstechnische Einrichtungen: Hierzu zählen u.a. Membran-Ausdehnungsgefäße zur Druckhaltung, Sicherheitsventile zum Druckablass bei Überdruck, Entlüfter (manuell oder automatisch) an höchsten Punkten, Absperrarmaturen und ggf. besondere Sicherheitseinrichtungen je nach Erzeuger (z. B. Gaswarngeräte im Kesselraum, Brandschutzabsperrklappen, etc.).
Für das vorliegende Projekt wird (angenommen) eine Gas-Brennwertkesselanlage als Primärsystem geplant, ergänzt um eine Luft-Wasser-Wärmepumpe für die Grundlastversorgung. Zusätzlich ist ein Fernwärmeanschluss als optionaler späterer Ersatz vorgesehen (z.B. Leerrohre für Fernwärme gelegt, falls zukünftig ein Anschluss erfolgt) – diese Annahme dient hier als Beispiel, wie unterschiedliche Systeme berücksichtigt werden. Im Hallenbereich sollen Deckenstrahlplatten installiert werden, in den Büros Flachheizkörper unter den Fenstern sowie stellenweise Fußbodenheizung (z.B. im Eingangsfoyer und in Sanitär-/Umkleideräumen, wo warme Böden gewünscht sind). In den Werkstätten kommen Lufterhitzer (wassergeführte Heizlüfter) zum Einsatz, um rasch Wärme bei geöffnenten Toren nachheizen zu können. Diese Kombination repräsentiert eine komplexe Heizungsanlage, die jedoch nicht unüblich ist.
Die Ausführungsplanung muss dieses Systemspektrum in Plänen und Schemata abbilden. So sollte es Lagepläne der Rohrleitungsführung, Strangschemata (Fließdiagramme) der gesamten Hydraulik und Detailzeichnungen der Heizräume und Stationen geben. Der Prüfer verschafft sich zunächst einen Überblick darüber, ob alle Systemkomponenten eingeplant sind und wie sie zusammenwirken. In einem vereinfachten Gesamtschema müsste z.B. erkennbar sein: Gas-Brennwertkessel und Wärmepumpe speisen gemeinsam einen Pufferspeicher; von dort gehen getrennte Heizkreise ab (z.B. einer für Hallen-Deckenstrahlplatten mit Mischventil auf 70 °C, einer für Büroheizkörper mit 55 °C, einer für Fußbodenheizung mit 40 °C, etc.). Die Fernwärme-Option könnte als Blindflansch vorgesehen sein. Wenn solche Zusammenhänge im Plan fehlen oder unklar sind, ist eine Vertiefungsplanung einzufordern, bevor die Freigabe erteilt werden kann.
Zur Veranschaulichung zeigt das folgende Bild einen Ausschnitt einer Heizraum-Installation mit Rohren, Armaturen und Messgeräten. Es verdeutlicht die Komplexität einer ordnungsgemäßen Anordnung, die in der Planung festgelegt und später vor Ort umgesetzt wird:
Beispiel: Rohrleitungssystem mit Messgeräten und Armaturen in einer Heizungsanlage. Bei der Prüfung wird das vorliegende Anlagenkonzept gegen die oben beschriebene Soll-Struktur gehalten. Man kontrolliert also beispielsweise: Sind alle vorgesehenen Wärmeerzeuger dimensioniert und in den Plänen verortet? Gibt es für jeden Gebäudebereich passende Wärmeabgabesysteme und wurden diese berechnet (Stückliste der Heizkörper etc.)? Wurden Puffer, Verteiler und Leitungen ausgelegt und beschriftet? Dies bildet die Grundlage für die tiefer gehende Prüfung nachfolgender Kapitel.
Prüfkriterien und -methodik der Ausführungsplanung
In diesem Abschnitt werden die spezifischen Prüfkriterien detailliert dargestellt. Die Prüfung erfolgt systematisch entlang der Hauptbestandteile der Heizungsplanung: von den Berechnungen über die technischen Komponenten bis hin zur betrieblichen Einbindung. Für jedes Themenfeld wird beschrieben, was geprüft wird, welche Anforderungen gelten und welche Unterlagen heranzuziehen sind.
Vollständigkeit und Qualität der Planungsunterlagen
Prüfpunkt: Liegt die vollständige Ausführungsplanung für die Heizungsgewerke vor, und ist die Dokumentation aussagekräftig und konsistent?
Eine erfolgreiche Prüfung setzt voraus, dass alle notwendigen Unterlagen vorhanden sind:
Zeichnungen/Pläne: Grundrisse mit Heizungsinstallationen (Lage der Heizkörper, Rohrverläufe, Steigleitungen), Schnitte bei relevanten Bereichen, Schemas (Heizungsanlagen-Fließschema, ggf. Funktionsschema für MSR).
Berechnungen: Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, Rohrnetzberechnung (Druckverlust- und Pumpenauslegung), ggf. Auslegungsnachweise für Wärmeübertrager (Heizflächen), Ausdehnungsgefäßberechnung, Pumpendimensionierung, Schornsteinberechnung (bei Kessel) etc.
Technische Datenblätter: Angaben zu vorgesehenen Hauptkomponenten (z.B. Kesselkennwerte, Wärmepumpen-Leistungsdaten bei versch. Temperaturen, Heizkörperlisten mit Typ/Größe/Leistung, Pumpenkennlinien, Armaturenlisten).
Leistungsbeschreibung/Vergabetexte: Eine Beschreibung der Leistungen, aus der hervorgeht, was der ausführende Unternehmer zu liefern hat, idealerweise mit Verweis auf Normen (DIN 18380 etc.) und inkl. Anlagenkennzeichnung.
Konzepte/Pläne für Automation und Sicherheit: Falls nicht in obigen enthalten, separate Unterlagen zur Gebäudeautomation (Punkteliste, Funktionsbeschreibung) und sicherheitstechnische Pläne (z.B. Feuerwehrplan, sofern Heizungsrelevant, oder Explosionsschutzdokument falls nötig bei Gaslagerung).
Der Prüfer kontrolliert zunächst indexmäßig, ob diese Unterlagen vollständig vorliegen. Jede Lücke (etwa fehlendes Schemas) wird moniert, da eine Freigabe ohne vollständige Planung nicht erfolgen kann. Danach wird die Konsistenz überprüft: Stimmen die Angaben in verschiedenen Dokumenten überein? Z.B. muss die Anzahl der Heizkörper in den Plänen mit der in der Berechnungsliste identisch sein. Oder die im Schema eingetragene Kessel-Nennleistung sollte mit dem Datenblatt übereinstimmen. In vielen Fällen werden solche Überprüfungen via Stichproben erfolgen.
Juristisch-technisch formuliert: Die Ausführungsunterlagen müssen ein in sich schlüssiges, widerspruchsfreies Ganzes bilden, damit sie als Grundlage eines Werkvertrags und der Bauausführung dienen können. Sollte es Diskrepanzen geben (z.B. Plan zeigt 2 Kessel, Auslegung berechnet nur 1 Kessel), muss vor Freigabe eine Klärung erfolgen (ggf. Plananpassung oder Berechnungsaktualisierung).
Zudem achtet die Prüfung auf die Detaillierungstiefe: Gemäß Leistungsphase 5 HOAI schuldet der Planer eine detaillierte Darstellung, aus der die Montage genau hervorgeht. Unklare Angaben – z.B. „Verlegung bauseits festlegen“ – deuten auf unzureichende Planung hin. Alle Komponenten sollten beschriftet sein (Kennzeichnung, Fabrikatvorschläge oder zumindest technische Spezifikationen).
Gerade bei Industriebauten ist auch die Koordination mit anderen Gewerken essenziell: Die Heizungspläne müssen mit Lüftungsanlagen, elektrotechnischen Einrichtungen und Baukonstruktion abgestimmt sein. Im Rahmen unserer Prüfung wird daher auf offensichtliche Kollisionen geachtet (etwa ein geplanter Heizkessel im Raum, der aber laut Architektenplan dort keinen Platz hat, oder Leitungsführungen durch Bereiche, die laut anderen Plänen unmöglich sind). Solche Auffälligkeiten fließen als Hinweis an die Planer zurück.
Ergebnis des Prüfschritts: Eine Liste der vorliegenden Unterlagen mit Vermerk „geprüft“ oder „fehlt/ergänzen“. Erst wenn die Vollständigkeit gegeben ist, geht es in die inhaltliche Prüfung der einzelnen Bereiche.
Heizlast und Anlagendimensionierung
Prüfpunkt: Ist die Heizlastberechnung nachvollziehbar und ist die Dimensionierung der Wärmeerzeuger und -verbraucher darauf abgestimmt?
Wie zuvor beim Thema DIN EN 12831 erläutert, bildet die Heizlastberechnung den Startpunkt jeder Auslegung. Die Prüfung dieses Aspekts umfasst:
Validierung der Randbedingungen: Stimmt die verwendete Norm-Außentemperatur mit der Region überein (z.B. in München ca. −12 °C, in Hamburg −9 °C, je nach Standort)? Stimmen die angenommenen Raumtemperaturen mit den Nutzungsanforderungen (Büroräume ~20 °C, Produktionshalle gemäß Absprache z.B. 16 °C, Lager frostfrei ~5 °C oder nach Notwendigkeit)? Wurden ggf. unbeheizte Nachbarräume korrekt berücksichtigt (Kühlt die Halle ins unbeheizte Freigelände oder an einen beheizten Nebenraum)?
Heizlastwerte plausibilisieren: Oft hilft hier der Vergleich Heizlast pro m² in ähnlichen Projekten. Beispielsweise könnte man erwarten: Büro ~60–80 W/m², Industriefertigung ~40–50 W/m² (abhängig von Hallenhöhe und Dämmung), Lager ~20–30 W/m². Liegen die berechneten spezifischen Lasten eklatant außerhalb solcher Erfahrungswerte, ist nachzuforschen warum. Der Prüfer kann sich beispielhaft einen repräsentativen Raum heraussuchen und dessen Heizlast überschlägig nachrechnen (z.B. mittels vereinfachter U-Wert- und Lüftungsansätze).
Berücksichtigung interner Gewinne und Lüftung: In Industriebauten können Maschinen oder Beleuchtung spürbare Wärme liefern; sind diese in den Büros oder Hallen angesetzt? Und wichtig: Falls Lüftungsanlagen mit eingebunden sind, wurde deren Wärmeverlust (Zuluft, Torlüftungsverluste) mit in die Heizlast gerechnet? Z.B. ein großes Hallentor, das regelmäßig öffnet, verursacht deutlichen Wärmebedarf, der zumindest über einen pauschalen Zuschlag berücksichtigt werden sollte.
Dimensionierung Wärmeerzeuger: Nach Durchsicht der Last wird geschaut, ob die Kesselleistung/Wärmepumpenleistung >= Heizlast ist. Hier ist nicht nur die Summe relevant, sondern auch der Betriebspunkt: Bei Wärmepumpen z.B. sinkt die Leistung mit tieferer Quelltemperatur. Hat der Planer dies bedacht? (Ein Praxisbeispiel: Eine Luft/Wasser-WP, Nennleistung 100 kW bei +7 °C Außentemp, bringt bei −12 °C evtl. nur 70 kW – das müsste entweder durch eine Hybridheizung oder mehrere WP kompensiert sein.) Der Prüfer verlangt i.d.R. das Leistungsdiagramm oder COP-Kurven der Wärmepumpe und prüft, ob ein bivalenter Punkt definiert ist, an dem der Gaskessel zuschaltet, um die Differenz zu decken. Ebenso bei Kesseln: Sind mehrere Kessel vorhanden, können sie gestaffelt die Last decken? (z. B. 2 Kessel à 500 kW für eine 700 kW Last, so dass bei Ausfall eines Kessels noch ~500 kW bereitstehen – Redundanzaspekt, siehe weiter unten).
Dimensionierung Heizflächen: Stimmen die Heizkörper-/Flächenheizungsdimensionierungen mit der Raumheizlast überein? Die Heizkörperliste sollte zu jedem Raum die berechnete Last und die ausgewählte Heizkörperleistung (bei Auslegungstemperatur) angeben. Der Prüfer sieht nach, ob da große Abweichungen sind (z.B. Raum Heizlast 1,5 kW, eingebauter Heizkörper nur 1,0 kW bei 70/55/20 °C – wäre unzureichend). Oder umgekehrt sehr große Überdeckung (1,5 kW Bedarf, 3 kW Heizkörper – ineffizient, kann aber mit Thermostatventil geregelt werden, jedoch zu hoch dimensioniert könnte auf absichtliche Reserve hindeuten). Leichte Überdimensionierung (10–15 %) pro Raum gilt oft als ok, um Aufheizzeiten zu verbessern, sofern dann die hydraulische Abgleichbarkeit gegeben ist.
Rohrnetz-Berechnung und Pumpenauslegung: Hier wird darauf geachtet, ob die berechneten Volumenströme zum Wärmebedarf passen (Volumenstrom = kW / (spez. Wärmekapazität * Temperaturdifferenz)). Wenn irgendwo ein auffälliger Wert auftaucht, wie z.B. extrem hohe Strömungsgeschwindigkeit (>2 m/s in Kupferrohr, was Erosionskorrosion begünstigen würde), ist das kritisch. Die Norm (DIN 1988 bzw. 4708 analog) empfiehlt je nach Rohrwerkstoff und DN ca. 0,5–1,5 m/s. Der Prüfer wird also stichprobenartig eine Rohrdimension und deren berechneten Durchfluss überprüfen. Ebenso ob der Druckverlust im Gesamtnetz zur Pumpenförderhöhe passt. Die Pumpenauslegung sollte im Plan angeben, welche Totalförderhöhe benötigt wird. Wenn z.B. 15 mWS erforderlich sind und der Planer schreibt Pumpe DN 65/130 – muss man sehen, ob deren Kennlinie überhaupt 15 mWS bei Nennförderstrom schafft.
Hydraulischer Abgleich vorgesehen: Ein immer wichtiger Punkt (auch vom GEG gefordert) ist der hydraulische Abgleich. Die Planung sollte Angaben enthalten, wie dieser erfolgen soll – etwa voreinstellbare Thermostatventile an Radiatoren, Strangregulierventile oder automatische Durchflussregler an den Steigsträngen etc. Die Prüfanweisung checkt, ob in der Ventilliste Komponenten zur Einregulierung vorgesehen sind. Falls nicht, wäre das ein Mangel, da ohne Abgleich insbesondere in weitläufigen Hallensystemen die Wärmeverteilung ungleich sein kann (die näher am Erzeuger liegenden Kreise würden ggf. zu viel Durchfluss erhalten, entfernte zu wenig).
Zentrale Wärmeerzeugung und Wärmeübergabe
Prüfpunkt: Entspricht die Auswahl und Auslegung der zentralen Wärmeerzeuger den Anforderungen des Projekts, und sind alle notwendigen Sicherheits- und Anschlussvorkehrungen getroffen?
In unserem Beispielprojekt besteht die zentrale Erzeugung aus einem Gas-Brennwertkessel sowie einer unterstützenden Wärmepumpe, mit optionalem Fernwärmeanschluss.
Gas-Heizkesselanlage: Hier ist zu prüfen, ob die Kessel aufstellungs- und sicherheitstechnisch korrekt geplant sind. Punkte sind u.a.:
Nennleistung und Anzahl der Kessel: Wie oben erwähnt, passt die Leistung zum Bedarf? Auch Teillastverhalten: Ein großer Kessel von 100 % Last vs. zwei mittlere je 50 % – was wurde gewählt? Bei 2 Kesseln kann einer als Reserve dienen, was für Verfügbarkeit gut ist (Redundanz). Prüfer vermerken, ob Redundanz vorhanden ist oder nicht, und ob dies akzeptabel ist (bei Bürogebäude und Halle ist Heizung unter Umständen kritisch im Winter, Redundanz ist daher wünschenswert).
Brennwerttechnik-Ausnutzung: Ein Brennwertkessel erzielt hohen Wirkungsgrad nur, wenn Rücklauftemperaturen niedrig sind (< 55 °C). Die Planung sollte daher sicherstellen, dass das System entsprechend ausgelegt ist (große Heizflächen, Mischersteuerung). Der Prüfer kontrolliert z.B. die Systemtemperaturen: Sind Heizkreise mit 80/60 °C geplant (klassisch) oder niedriger, z.B. 60/40 °C? Wenn sehr hohe Vorlauftemp. vorgesehen sind (über 70 °C konstant), würde das den Brennwerteffekt mindern – hier könnte der Prüfer nachfragen, ob eine Rücklaufanhebung vorhanden ist oder warum die Temperaturen so hoch nötig sind.
Aufstellung und Raumluftverbund: Der Kesselraum muss meist bestimmte Anforderungen erfüllen (Verbrennungsluftöffnungen, ggf. Explosionsschutz bei Gas, Brandschottung). Im Plan sollte verzeichnet sein, wo die Verbrennungsluftzufuhr ist. Ist es ein Raum mit Außenwandöffnungen oder wird Luft über Schächte zugeführt? Gibt es Gaswarner (bei > 50 kW Gasleistung oft vorgeschrieben in Heizräumen)? Sind die Türen feuerbeständig (Feuerschutzabschlüsse), falls der Heizraum im Gebäudeinneren liegt? Solche Aspekte liegen oft an der Schnittstelle TGA/Bau – der Prüfer spricht es an, sollte aber erwarten, dass der Planer hierzu Notizen hat (im Zweifelsfall muss die Bauplanung das sicherstellen, aber die TGA-Planung sollte Anforderungen kommunizieren).
Abgasanlage (Schornstein): Die Abgasführung eines Brennwertkessels (i.d.R. Kunststoff- oder Edelstahl-Abgassystem) muss dimensioniert und geplant sein. Steht im Plan die Abgashöhe, Durchmesser und Verlauf? Hält dieser die Brandschutzabstände ein? (z.B. Doppelwandig isoliert durch Geschosse). Auch die Kondensatableitung (Neigung, Kondensatanschluss ans Abwasser mit Neutralisationseinrichtung) sollte im Schema oder Text erwähnt sein. Der Prüfer wird fragen, ob die Abgasanlage nach 1. BImSchV konzipiert ist (die Verordnung über kleine Feuerungsanlagen regelt Emissionsgrenzwerte und z.B. dass ein Kondensatkessel Neutralisationsbox braucht etc.).
Druckhaltung und Sicherheit: Für die Kesselanlage relevant ist die Druckstufe. Wie aus den technischen Regeln hervorgeht, sind Standardheizkessel bis 120 °C Vorlauf in Gruppe II der DampfkesselVO eingruppiert. Die Planung muss hier sicherstellen, dass gemäß TRD 702 (Technische Regel Druckbehälter) die Ausrüstung passt – d.h. u.a. Sicherheitsventile in ausreichender Größe, geprüftes Ausdehnungsgefäß, Manometer, Schnellentlüfter. Der Prüfer sieht im Schema nach: sind dort Sicherheitsventile eingezeichnet (und wenn ja, mit welchem Ansprechdruck)? Ist ein Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) dimensioniert (steht z.B. „MAG 1000 Liter, Vordruck X bar“)? Fehlt sowas, ist das ein schwerwiegendes Versäumnis – ohne Druckhaltung funktioniert das System nicht. Zudem wird nach der Auffangmöglichkeit für austretendes Wasser geschaut (Sicherheitsventile müssen ins Freie oder einen Trichter leiten, damit im Überdruckfall heißes Wasser kontrolliert abgeleitet wird und niemand gefährdet).
Genehmigungspflichten: Sollte die Kesselanlage sehr groß dimensioniert sein (hier vermutlich nicht, aber genereller Hinweis), greift evtl. das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Anlagen > 10 MW (Gas) bzw. > 5 MW (Öl) wären genehmigungspflichtig nach 4. BImSchV. Für unser Projekt unrealistisch, aber der Prüfer hat dennoch einen Blick auf die Leistung. Weiters relevant: Kessel über 1 MW müssen bei Inbetriebnahme vom Schornsteinfeger oder Prüfsachverständigen abgenommen werden; der Plan sollte entsprechende Messöffnungen vorsehen.
Schnittstelle Fernwärme (optional): Falls wie angenommen ein perspektivischer Fernwärmeanschluss vorgesehen ist, wird geprüft, ob im Heizraum ein geeigneter Platz und Anschlüsse dafür berücksichtigt sind. Beispielsweise könnte im Schema stehen: „Blindanschlüsse für Fernwärmevor- und -rücklauf DN 100, vorgesehen im Bodenbereich Heizraum Nordwand“ – damit kann später eine Fernwärmestation angebunden werden. Fehlt das, wäre es schwer, später ohne größere Umbauten anzuschließen.
Wärmepumpen-Anlage: Bei einer unterstützenden Wärmepumpe (z.B. 100 kW Luft-WP) überprüft man:
Aufstellungsort: Ist die Wärmepumpe außen oder innen? Falls außen (Außengerät), ist ein entsprechender Standortplan vorhanden? Lärmschutz ist hier ein Thema: Erfüllt die Position die TA Lärm Anforderungen (Abstand zu Büros/Fenstern)? Die Planer sollten Daten zum Schallpegel liefern, und ggf. Aufstellmaßnahmen (Schwingungsdämpfer etc.).
Leistung und Arbeitszahlen: Wie erwähnt, die WP-Leistung bei Norm-Außentemp. Der Prüfer möchte sehen, bis zu welcher Temperatur die WP heizt und wann ggf. der Kessel übernimmt (bivalenter Punkt, z.B. −5 °C). Zudem interessant: Hat die WP einen Pufferspeicher im Kreis? Viele WP brauchen einen Mindestumlaufvolumen, oft wird dafür ein Pufferspeicher (z.B. 500 L) eingeplant. Der Prüfer checkt, ob ein solcher im Schema ist und korrekt eingebunden (Reihen- oder Paralellpuffer je nach Konzept).
Notheizung/Heizstab: Hat die WP elektrisch Heizelemente integriert (oft bei WP nominell 100 kW sind 2x9 kW E-Heizstäbe drin für Frostfall)? Wurde das im Elektroanschluss berücksichtigt? Wenn ja, der Prüfer wird nach Lastmanagement fragen, falls das große Verbraucher sind.
Quellensystem: Bei Luft-WP – sind die Luftkanäle oder Freiaufstellung ok? Bei Erd-WP (Sole) – sind die Erdbohrungen geplant (Lageplan mit Bohrpunkten) und hat das wasserrechtliche Erlaubnis? Bei Wasser-WP – Brunnen etc. (unwahrscheinlich hier). In unserem Fall vermutlich Luft-WP Dachaufstellung. Dann zu prüfen: Statik Dach, Schallschutz, Vereisungskondensat Ablauf.
Einbindung mit Kessel: Parallel- oder seriell geschaltet? Der Plan muss klar zeigen, wie die WP und der Kessel zusammenarbeiten. Z.B. beide speisen in einen gemeinsamen Vorlauf via Rücklaufsammelschiene, oder WP speist in Pufferspeicher, Kessel geht bei Unterschreiten via Mischer rein. Der Prüfer wird ein besonderes Auge auf Rückflussverhinderer oder hydraulische Weichen legen, damit sich die Systeme nicht gegenseitig beeinflussen.
Fernwärme-Hausstation (falls vorhanden):
Sollte das Projekt stattdessen oder zusätzlich an Fernwärme hängen, ist die Übergabestation Prüfgegenstand. Diese besteht i.d.R. aus Wärmetauschern, Regelventilen, Druck- und Temperaturreglern, Messgeräten (Wärmemengenzähler, Drucküberwachung) und Absperrungen zwischen dem Versorgernetz (Primärseite) und der Gebäudeanlage (Sekundärseite).
Der Prüfer kontrolliert:
Direkte vs. indirekte Einspeisung: Bei direkter Einspeisung fließt Fernwärmewasser direkt durchs Gebäude-Heiznetz, bei indirekter trennt ein Wärmetauscher die Kreise. Die Versorger schreiben meist die Art vor. Die Planung muss dem entsprechen. Indirekt ist üblich bei höheren Drücken/Temperaturen im Netz. Direkteinspeisung erfordert, dass alle Anlagenteile den Netzdruck aushalten und im Leckfall große Mengen Netz-Wasser ins Gebäude gelangen könnten. Für die Prüfung: Ist die Anschlussart dokumentiert? Z.B. im Vertrag mit dem FVU. Und sind die Druckstufen richtig gewählt (z.B. bei indirekt könnte Hausnetz nur PN 6 bar sein, bei direkt evtl. PN 16 bar).
Wärmetauscher-Auslegung: Stimmen primäre und sekundäre Parameter? (Fernwärme z.B. 100/60°C Primär, Sekundär ausgelegt 80/50°C). Der Prüfer achtet auf die Rücklauftemperaturbegrenzung, die viele Fernwärmeversorger fordern (meist max. 60°C Rücklauf). Plant der TGAler dafür etwas? (z.B. hydraulische Weiche, Mischsteuerung).
Druckhaltung und Sicherheitsventile: Bei indirekter Übergabe hat die Hausanlage eigene Druckhaltung (MAG, SV) – das muss da sein. Bei direkter kann es sein, dass Versorger den Druck regelt, aber i.d.R. sollte dann auch ein Sicherheitsventil in der Anlage sein, angepasst an Versorger-Ansprechdruck. Der Prüfer prüft dies streng, denn Überdrucksicherheit ist eine Grundvoraussetzung.
Vertragsübergabepunkt: Oft wird abgegrenzt, bis wohin die Verantwortung Versorger vs. Kunde geht (häufig am Absperrventil vor dem Wärmetauscher). Der Plan sollte diese Schnittstelle definieren.
Mess- und Regelkomponenten: Fernwärme erfordert einen geeichten Wärmemengenzähler, der meist vom Versorger geliefert wird, aber in der Planung sollte der Einbauplatz vorgesehen sein (gerade Strecken vor/nach etc.). Ebenfalls ein Druckregler falls Versorger das verlangt (z.B. Druckhalteventil auf Rücklauf). Der Prüfer schaut, ob im Schema all diese Teile auftauchen.
In allen diesen Erzeugungs-Subsystemen gilt es ferner zu überprüfen, ob Notfallszenarien bedacht sind: Gibt es eine Noteinrichtung? Z.B. Not-Aus Schalter im Heizraum, der Gas absperrt und Kessel abschaltet – vorgeschrieben gemäß Technischen Regeln Gasinstallation (TRGI) ab bestimmten Leistungen. Wurde im Plan ein Gas-Absperrmagnetventil mit Not-Aus Taster vorgesehen? Wenn nein, nachfordern, denn in vielen Bundesländern ist das Pflicht für gewerbliche Heizzentralen > 100 kW. Auch ob Rauchabzug im Heizraum (Brandschutz) realisiert wird, könnte Thema sein.
Abschließend in diesem Bereich beurteilt der Prüfer noch die zugesicherte Energieeffizienz: Hat der Planer Kennzahlen angegeben wie Kesselwirkungsgrad, Jahresnutzungsgrad, Jahresarbeitszahl WP? Sind diese realistisch und erfüllt das System damit die Anforderungen (z.B. GEG oder Fördermittel-Kriterien)? Gegebenenfalls werden im Plan die Herstellerangaben angezogen; hier muss man darauf achten, dass diese unter Normbedingungen gelten und im realen Betrieb abweichen können.
Die Prüfanweisung wird festhalten, ob die Wärmeerzeugung insgesamt schlüssig geplant ist. D.h. keine Komponente fehlt, Sicherheitsfragen geklärt, Dimensionierung passend. Kritikpunkte könnten lauten: „Kein Gaswarnmelder im Heizraum vorgesehen – nachrüsten nach Techn. Regel Gas“, oder „Wärmepumpenleistung zu gering für tiefe Temperaturen, bivalenten Punkt neu festlegen“, oder „Fernwärmestaton: Rücklauftemperatur-Regelung unklar – bitte Konzept darstellen“.
Wärmeverteilung, Rohrnetz und Hydraulik
Prüfpunkt: Ist das Verteilungssystem der Heizwärme (Rohrnetz, Pumpen, Speicher) korrekt ausgelegt und hydraulisch einwandfrei konzipiert?
Dieser Teil betrachtet alles „zwischen“ Erzeuger und Verbraucher, also Rohre, Pumpen, Ventile, Speicher, hydraulische Weichen usw. Wesentliche Unteraspekte:
Rohrleitungsführung und -dimensionierung: Die Pläne sollten den Verlauf der Hauptleitungen (Vorlauf/Rücklauf) vom Heizraum in alle Gebäudeteile zeigen, inklusive Dimensionen (Durchmesser) und Materialien. Der Prüfer kontrolliert, ob die Dimensionen zur Durchflussmenge passen (siehe auch vorher Rohrnetzberechnung). Die Fließgeschwindigkeiten sollten in vernünftigen Grenzen liegen, um Strömungsgeräusche und Erosion zu vermeiden. Typisch: In Steigleitungen und Verteilern < 1,5–2 m/s, in kleineren Endleitungen evtl. < 0,8 m/s. Wird die Norm DIN 1988-300 (Trinkwasser) hier analog angesetzt? – Eher nicht, es gibt für Heizung keine eigene Norm, aber Erfahrungswerte. Der Prüfer schaut auf die längste bzw. ungünstigste Strecke: ist dort ein Druckverlust angegeben? Und reicht die Pumpenförderhöhe?
Pumpenauswahl: Die Planung enthält meist eine Pumpentabelle mit Typ, Förderstrom, Förderhöhe, Motorleistung. Der Prüfer vergleicht, ob die Pumpen mit effizienter Technik ausgestattet sind (heutzutage Pflicht: hocheffiziente elektronische Pumpen gemäß Ökodesign-Richtlinie). Weiterhin ob die Pumpe im Arbeitspunkt in einem guten Wirkungsgradbereich liegt. Wenn z.B. die Berechnung 10 m³/h bei 8 mWS ergibt und die gewählte Pumpe schafft bis 12 m³/h 8 mWS, klingt das plausibel. Wenn aber eine Pumpe ausgewählt ist, die viel zu groß ist (z.B. 10 m³/h Bedarf, aber Pumpe 20–40 m³/h), dann würde sie ständig im Teillast-Minimalbereich laufen – ineffizient.
Außerdem wird geprüft, ob Reservepumpen vorgesehen sind für kritische Kreise. Bei sehr wichtigen Heizkreisen (z.B. Fernwärme-Primärkreis) baut man manchmal zwei Pumpen parallel, eine davon als Ersatz (automatische Umschaltung bei Ausfall). Ist im Plan z.B. ein Pumpendoppel eingezeichnet? Falls nein, und es handelt sich um single point of failure, könnte der Prüfer empfehlen, darüber nachzudenken (abhängig von Redundanzstrategie).
Pumpschaltungen: Wichtiger Aspekt: Hat jeder Heizkreis seine eigene Pumpe? Häufig ja: z.B. eigener Heizkreis Hallenheizung mit Mischer und Pumpe, eigener Kreis FB-Heizung mit Mischer und Pumpe, etc. Sind diese im Schema klar dargestellt und elektrisch/steuerungstechnisch verbunden (z.B. Pumpe stoppt, wenn kein Wärmebedarf)?
Hydraulisches Schema & Weiche/Puffer: Hydraulisches Schema & Weiche/Puffer:
Die Prüfer sehen sich das Hydraulikschema genau an. Hier gilt es, Fehler zu entdecken wie: Fehlende Rückschlagklappen wo nötig (damit z.B. die Pumpen nicht rückwärts durch einen stillstehenden Zweig drücken); falsche Anbindung von Pufferspeichern (z.B. wenn Vorlauf/Rücklauf vertauscht).
Eine hydraulische Weiche (auch „Hydraulikkupplung“ genannt) wird oft zwischen Erzeuger und Verbraucher-Kreisen eingebaut, um die Volumenströme zu entkoppeln. Ist diese vorgesehen? Wenn nein, hat stattdessen der Pufferspeicher diese Funktion? Der Prüfer klärt, ob der Planer hier die richtige Philosophie verfolgt. Bei parallelen Wärmeerzeugern (Kessel+WP) ist eine Weiche oder Puffer fast immer nötig, um Konflikte zu vermeiden.
Pufferspeicher: Falls vorhanden, wird dessen Volumen gecheckt. Eine Faustformel ist pro kW Wärmepumpenleistung ca. 20–30 Liter Puffervolumen (um Takten zu reduzieren). Entspricht das dem gewählten 1000 L bei 50 kW WP? Wenn eklatant abweichend, nachfragen. Auch Lade- und Entladestrategie: Der Puffer sollte richtig angeschlossen sein (z.B. 4-Leiter-Anschluss bei Mischbetrieb). Der Prüfer schaut, ob die Schichtung bedacht ist – oft oben Vorlauf raus, unten Rücklauf rein. Manchmal zeichnen Planer nur „Puffer“ an, ohne intern Bauteile – okay, aber man sollte sehen, wo Sensoren sitzen (ganz oben, mitte, unten?).
Abgleich/Regelventile: Sind an strategischen Punkten Regulierventile eingebaut? Z.B. an Steigsträngen in hohe Gebäudeteile – damit man strömungsmäßig abgleichen kann. Der Prüfer sieht im Plan nach Symbolen oder Bezeichnungen (oft RL = Rücklauf mit Regulierventil). Das Fehlen solcher Ventile wäre ein Hinweis, dass hydraulischer Abgleich nicht möglich ist.
Absperrungen und Wartung: Jedes Hauptgerät (Pumpe, Wärmeerzeuger, Wärmetauscher) sollte absperrbar sein, damit es ohne Entleeren der ganzen Anlage gewartet werden kann. Der Prüfer schaut, ob vor und hinter jeder Pumpe Ventile sind, ob Bypässe oder Überströmventile vorgesehen sind (gerade bei thermostatischen Heizkörperventilen in einem Kreis ohne Überströmmöglichkeit könnte im Teillastfall die Pumpe gegen geschlossene Ventile arbeiten – daher baut man entweder ein Überströmventil oder eine drehzahlgeregelte Pumpe, die selbst runterregelt). Die Planung sollte letzteres bevorzugen.
Temperatur-Niveaus und Mischer: Wenn verschiedene Verbraucher unterschiedliche Temperaturen brauchen (Halle vs. Büro vs. FB-Heizung), sind entsprechende Mischer eingeplant? Der Prüfer checkt: Gibt es z.B. einen 3-Wege-Mischer + Mischerpumpe für den Fußbodenkreis? Falls nein, wie wird dort sonst die Temperaturreduzierung erreicht? Sollte es fehlen, ist das ein gravierender Planungsfehler – Fußbodenheizung darf man nie direkt mit 70 °C beaufschlagen. Ähnlich, falls Radiatoren 70 °C und Deckenstrahlplatten 90 °C bräuchten, wie wird das getrennt? Der Plan muss dafür separate Kreise haben.
Werkstoffe und Korrosionsschutz:
Oft wird im Plan angegeben, welches Rohrmaterial wo verwendet wird (Stahl schwarz, verzinkt, Kupfer, Kunststoffverbund). Die Prüfer hinterfragen, ob das mit dem System kompatibel ist. Beispiel: In Verbindung mit Fernwärme (Sauerstoff im Wasser) sind Kunststoffrohre ungünstig wegen Diffusion – da besser Stahl. Oder bei hoher Vorlauftemperatur in Deckenstrahlplatten (z.B. 90 °C) könnte ein Kunststoffrohr im Betonproblematisch sein – hier lieber Metall. Das muss kohärent sein.
Falls verschiedene Metalle verwendet werden (Kupfer + Stahl), galvanische Korrosion vermeiden – d.h. in der Planung sollte man Mischinstallationen nur machen, wenn entsprechender inhibitor im Wasser (wieder VDI 2035 Aspekt).
Erweiterungs- und Reservemöglichkeiten:
Ein qualitatives Kriterium: Hat der Planer z.B. Reservestutzen vorgesehen für zukünftige Erweiterungen? In einem Industriebau könnte Phase 2 eine weitere Halle sein – ist es möglich, die Anlage zu erweitern? Der Prüfer vermerkt positiv, wenn z.B. ein Reserveabgang DN 80 am Verteiler eingezeichnet ist. Das zeigt Weitblick. Ist natürlich kein Muss, aber im Sinne von Nachhaltigkeit (Späterer Umbau minimal) sehr wünschenswert.
Zusammenfassend achtet die Prüfung in diesem Bereich darauf, dass das hydraulische Gefüge stabil und regelbar ist. Alle Komponenten vom Erzeuger bis zu den Entnahmestellen sollen so dimensioniert und angeordnet sein, dass jeder Verbraucher bedarfsgerecht Wärme bekommt, ohne dass es irgendwo zu viel oder zu wenig Durchfluss gibt. Und dass im Teillastfall (häufiger Betriebszustand) die Anlage nicht unnötig Energie verschwendet (Pumpenüberförderung, Wärmeverluste, Rückmischung etc.). Der hydraulische Abgleich gemäß VDI 2073 bzw. Annex zu DIN EN 14336 ist ein Muss.
Typische Findings in Prüfberichten sind etwa: „Strang X zum Westflügel: Keine Einstellmöglichkeit vorgesehen – Planer wird gebeten, ein Regelventil einzuplanen.“ Oder „Die beiden Heizkreispumpen drücken gegeneinander in gemeinsamen Rücklauf – bitte Rückschlagventile vorsehen, sonst Kurzschlussströme möglich.“ Oder „In der Schemazeichnung fehlt ein Ausdehnungsgefäß in Nebenkreis Y – ist die Druckhaltung dafür mit vorgesehen? Nachtragen.“ Solche Punkte werden mit Bezug auf Normen (VDI 2035, DIN 18380 etc.) begründet.
Wärmeabgabesysteme (Heizflächen)
Prüfpunkt: Wurden die vorgesehenen Wärmeübergabeeinrichtungen (Heizkörper, Flächenheizung, Hallenheizer etc.) korrekt dimensioniert, positioniert und hinsichtlich Regelbarkeit und Nutzeranforderungen geplant?
Hier geht es um das Ende der Kette – die Art und Weise, wie die Wärme in die Räume eingebracht wird.
Radiatoren / Konvektoren in Büros und Sozialräumen: Die Planung sollte einen Heizkörperplan je Raum enthalten. Der Prüfer kontrolliert:
Anzahl und Größe passend zur Raumheizlast: Wie zuvor erwähnt, im Abgleich mit der Heizlastliste. Wichtig ist auch die Angabe der Systemtemperaturen, denn die Heizkörperleistung hängt davon ab. Wenn z.B. 22 °C Innen, 70/55 °C System, dann hat ein Typ-22-Radiator 600x1000mm vielleicht 1 kW Leistung. Bei 45/35 °C (Wärmepumpenbetrieb) hätte derselbe nur ~0,4 kW. Die Planung muss also stimmig sein: Entweder große Flächenheizkörper oder höhere Temperaturen. Der Prüfer achtet auf diesen Abgleich.
Platzierung im Raum: Heizkörper gehören i.d.R. unter Fenster (Kaltluftabschirmung). Sind alle geplanten Heizkörper so positioniert? Im Plan ersichtlich? Falls mal wo keiner unterm Fenster eingezeichnet ist, aber ein großes Fenster existiert, fragt man nach (vielleicht Fußbodenheizung dort?). Ebenso: sind Heizkörper in Nischen oder hinter Verkleidungen? Dann Leistungsverluste einberechnen – war das gemacht?
Thermostatventile / Stellantriebe: Jeder konventionelle Heizkörper braucht ein Regelventil, meist Thermostatkopf. Im Plan (Stückliste) sollten thermostatische Heizkörperventile aufgeführt sein. Der Prüfer wird auch random schauen, ob jedes Zimmer ein eigenes Ventil bekommt – also keine zwei Räume über einen gemeinsamem Ventil (wäre unsinnig, kommt aber bei Großraumbüro vor, da teilt man auf Zonen auf). Wenn das Gebäudeautomation hat, könnten stattdessen motorische Stellantriebe und Raumthermostate eingesetzt werden (z.B. in hochwertigen Büros). Dann müsste das in GA-Konzept stehen.
Besondere Räume: In Konferenzsälen oder EDV-Räumen könnte man andere Emitters wählen (z.B. Kühldecken? Aber primär Heizung hier). Prüfer fragt: war Fußbodenheizung in Foyer geplant statt Radiatoren? Dann wird dort ja ein Mischkreis sein – ist das in Heizflächenauslegung vorhanden?
Flächenheizung (Fußbodenheizung): Wenn vorgesehen (z.B. Foyer, Sanitär):
Verlegesystem und Rohrabstände: Der Planer sollte ein Schema der FB-Heizung haben. Oft wird eine gleichmäßige Verlegung mit 10, 15 oder 20 cm Abstand je nach Wärmebedarf vorgesehen. Der Prüfer interessiert: Reicht das, um die benötigte Flächenleistung zu erbringen (W/m²)? Bei typ. 35 °C Vorlauf kann man ca. 70 W/m² dauerhaft übertragen. Für Büros reicht das meist, für ein Werkstattboden ggf. knapp. Sind dort also eventuell engere Abstände oder zusätzliche Heizkörper an Wänden?
Maximale Oberflächentemperaturen: Normen begrenzen die Fußbodentemperaturen (28 °C in Aufenthaltsräumen, 33 °C in Bädern etwa), um Behaglichkeit sicherzustellen. Die Auslegung sollte sich daran halten. Der Prüfer wird das nicht nachrechnen, aber erwarten, dass der Planer Normkonform arbeitet – sprich, bei Verlegeabstand und Temperatur das bedacht hat.
Hydraulischer Anschluss: Meist hat man einen Verteilerkasten pro Geschoss oder Bereich, wo die einzelnen Heizschlangen angeschlossen sind mit Regulierventilen und Durchflussanzeigern. Ist dieser in Zeichnungen eingezeichnet und gut zugänglich geplant? (z.B. nicht im abgesperrten Technikraum, sondern zugänglich für Service).
Regelung: FB-Heizung reagiert träge. Oft belässt man die Grundlast via FB und nutzt Radiatoren für Schnellaufheizung, aber wenn reiner FB, dann gibt’s Thermostate mit Raumfühlern und Ventile an Verteilern. Der Prüfer sieht nach, ob Raumthermostate und Stellmotoren am Verteiler vorgesehen sind. Gern auch ein Mischer (begrenzte Vorlauftemp), falls vom Hauptkreis zu heiß.
Deckenstrahlplatten / Industriepaneele: In hohen Hallen werden gerne wassergeführte Deckenstrahlplatten (unter der Decke hängende Paneele, die Wärme abstrahlen) genutzt. Prüfung:
Auslegung und Anordnung: Die Anzahl der Platten muss die Hallenheizlast decken. Verteilung möglichst gleichmäßig, in Aufenthaltszonen eventuell dichter. Prüfer vergleicht, ob Flächendichte plausibel (z.B. bei 1000 m² Halle vielleicht 10 Paneele à 10 kW?). Und ob sie sinnvoll platziert (über Arbeitsbereichen vs. Verkehrswegen).
Aufhängehöhe und Typ: Steht im Plan was zur Montagehöhe? Je höher, desto mehr Strahlungsleistung nötig. Hersteller geben Diagramme vor. Prüfer kann hinterfragen, ob der Planer diese berücksichtigte.
Temperaturniveau: Deckenstrahlplatten benötigen oft höhere Vorlauftemp, z.B. 85/60 °C, um ausreichend zu strahlen. Der Plan sollte daher einen separaten Hochtemperaturkreis haben. Der Prüfer schaut im Schema: Gibt es “HK Hallenstrahler 85/60” separat? Wenn nein, und stattdessen an 60/40 °C WP-Kreis angehängt, würde Halle nie warm. Das wäre ein eklatanter Fehler – unbedingt zu korrigieren.
Regelung: Strahlplatten können zonenweise geregelt sein (z.B. nach Hallenschiffen). Sind entsprechende Zonenventile und Thermostate geplant? Falls die Halle nicht homogen genutzt, vielleicht gibt’s einen Tagesschaltbetrieb oder Wochentimer (z.B. nachts absenken).
Lufterhitzer / Lüftungsanlagen: In Werkstätten oder großen Hallen ergänzen oft Lufterhitzer (Gebläsekonvektoren) die Heizung, insbesondere um nach Türöffnungen schnell aufzuheizen. Hier achtet man:
Luftwurf und Platzierung: Die Geräte müssen so angeordnet sein, dass sie den Raum abdecken. Z.B. an Wand über Tor oder unter Decke in Ecke blasend. Plan zeigt das als Symbole. Prüfer checkt, ob ‘Schattenbereiche’ bleiben (kalte Ecken).
Leistung & Vorlauf: Meist werden Lufterhitzer auf 70/50°C oder 80/60°C ausgelegt. Stimmen die Datenblätter mit dem geplanten Vorlauf? Und decken kW vs Raumvolumen?
Geräusch: In Arbeitsbereichen dürfen die Gebläse nicht zu laut sein. Planer oft wählen passende Stufe, aber Prüfer kann nachfragen, ob Schallpegel bekannt und akzeptabel (Angabe in dB(A) vllt. im Datenblatt).
Steuerung: Im Idealfall thermostatisch gesteuert, evtl. mit zwei Stufen (langsam konstant vs schnell bei Bedarf). Der Plan sollte Schaltpunkte definieren (vielleicht via GA).
Filter/Wartung: Lufterhitzer ziehen Staub – Filter oder leicht zu reinigen? In dreckiger Industriehalle muss man es mit bedenken.
Falls an eine Lüftungsanlage angeschlossen (z.B. zentrale RLT mit Heizregister), dann muss in Heizlast angerechnet sein und die Heizleistung fürs Register vorgehalten. Prüfer guckt, ob in der Heizlastberechnung ein Posten "Lüftung 50 kW" o.ä. enthalten war, und ob im Heizungsschema der Registeranschluss auftaucht.
Spezialfälle:
Sollte es in dem Industriegebäude Prozessheizungen geben (z.B. Galvanik-Bäder, die beheizt werden, oder Frostschutz für Sprinkler), muss das ebenfalls in Planung sein. Der Prüfer wird das Projekt kennen und gezielt nach solchen Punkten fragen. Sprinkler zum Beispiel, falls frostgefährdet, könnte über Heizschleifen in Sprinklerbehältern realisiert sein.
In Summe stellt die Prüfung der Wärmeabgabesysteme sicher, dass die Raumwärmebedarfe gedeckt werden können und die Nutzer die Wärme auch regulieren können. Eine Überhitzung oder Unterversorgung einzelner Räume wäre ein Planungsfehler. Auch Komfortkriterien werden betrachtet: Fußbodentemperaturen, Strahlungswärmeanteil (z.B. Strahlplatten gelten als angenehm, Warmluftgebläse eher weniger – aber nötig für Torbereiche). Gegebenenfalls machen Prüfer Verbesserungsvorschläge: z.B. „Im Wareneingang nur Lufterhitzer vorgesehen – Vorschlag: zusätzlich Fußbodenheizung im Torbereich als Grundtemperierung“, oder „Büro Heizung ausschließlich über FB-Heizung – im Hinblick auf Behaglichkeit sollte geprüft werden, ob ergänzend Wandheizkörper für schnelle Reaktionszeit sinnvoll sind.“ Solche Hinweise speisen die Rückkopplung zwischen Planung und FM, weil FM die Betriebserfahrung einbringt („typischer Fehler, nur Fußboden in Konferenzraum – zu träge, Nutzer beschweren sich“).
Nicht zuletzt wird auch kontrolliert, ob ausreichende Reserven für extrem kalte Tage oder Nutzungsänderungen da sind. Heizkörper kann man i.d.R. zu 30 % überdimensionieren ohne Nachteil (dann drehen Thermostate halt früher zu), das erhöht aber Reserve. Wenn Planer sehr knapp dimensionieren, kann FM empfehlen, leichte Reserve einzuplanen. Das muss austariert werden im Sinne Kosten vs Nutzen.
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (Gebäudeautomation)
Prüfpunkt: Ist die Heizungsanlage mit einer geeigneten Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR) ausgestattet, die einen sicheren, effizienten und automatisierten Betrieb ermöglicht, und ist die Einbindung in die Gebäudeautomation gewährleistet?
Dieser Prüfabschnitt knüpft an die vorher erläuterten Anforderungen aus VDI 3814 und DIN EN 15232 an, geht aber konkret auf die umgesetzte MSR-Planung ein.
Regelungskonzept: Der Prüfer erwartet ein Regelungsschema oder eine Funktionsbeschreibung, die die wichtigsten Funktionen darstellt:
Witterungsführung: Meistens haben Heizkreise eine Heizkurve, die abhängig von der Außentemperatur die Vorlauftemperatur regelt. Z.B. bei 0 °C außen ergibt 60 °C VL, bei +10 °C außen 30 °C VL (lineare Heizkurve). Ist dies vorgesehen? Normalerweise in jeder modernen Kessel- oder Wärmepumpenregelung integriert. Der Plan sollte einen Außentemperaturfühler vorsehen (Symbol AT-Fühler). Prüfer schaut: ist im Schema oder auf der GLT-Punktliste ein AT-Fühler enthalten? Ohne den wäre Witterungsführung nicht möglich. Also falls fehlt -> Mangel.
Raumtemperatur-/Zeitprogramm: Büros z.B. werden nachts abgesenkt (Heizungsabschaltung oder Absenktemperatur ~16 °C). Ist in der Steuerung ein Zeitprogramm vorgesehen? In der Funktionsbeschreibung könnte stehen: „Zeitschaltuhr für Heizbetrieb, Werktags 6–18 Uhr Normalschaltung, sonst Absenkbetrieb 16 °C, vor Feiertagen manuell einstellbar, etc.“. Wenn so etwas nicht dokumentiert ist, fragt der Prüfer nach. In der GLT kann man das realisieren, aber Planung muss zumindest die Möglichkeit vorsehen (z.B. Raumthermostate mit Zeitprogramm oder DDC-Programm).
Regelkreise: Jeder hydraulische Kreis braucht eine Regelstrategie: Mischer mit Vorlauftemp-Fühler steuert nach AT-Kurve, Pumpenmodulation nach DP-Sensor oder Konstantdruck (bei Thermostatventilen). Der Prüfer guckt ins Schema: Sind Mischer als „motorisch“ gekennzeichnet? Sind Fühler (Vorlauf VL-F, Rücklauf RL-F) eingezeichnet? Gibt es Differentialdruckgeber in großen Netzen zur Pumpensteuerung? Ein Indiz: vorgesehene Pumpen mit FU (Frequenzumrichter) – dann braucht’s irgendwo ne Führungsgröße (DP oder Temperature). Planung sollte das beschreiben, z.B. im Text: „Die Heizungspumpen sind drehzahlgeregelt, Führungsgröße ist der Druck im Verteiler (Sensor installiert)“.
Kaskadensteuerung (bei mehreren Wärmeerzeugern): Die Abstimmung zwischen Wärmepumpe und Kessel in unserem Beispiel: Wer läuft wann? Der Prüfer möchte sehen, ob eine sogenannte Kaskaden- oder Verbundregelung vorgesehen ist, die je nach Außentemperatur bzw. Last die WP priorisiert und den Gas-Kessel nur zuschaltet, wenn WP nicht mehr reicht oder ausfällt. Oft bieten Hersteller dafür fertige Regler an. Im Plan könnte stehen: „Regelung: Fabrikat xy, mit integr. Kaskadenmodul“. Wenn das fehlt, riskiert man ineffizienten Parallelbetrieb. Also deutlich ansprechen, falls unklar.
Sommer-/Winter-Umschaltung: In warmen Jahreszeiten soll Heizung aus (es sei denn für Brauchwasser, aber in Industrie vllt. irrelevant). Ist da was vorgesehen? (z.B. Kesselabschaltung bei AT > 15 °C). Der Prüfer kann diese Feinheiten erfragen – oft Standard in modernen Reglern, doch gut, wenn dokumentiert.
Messausrüstung: Eine gute Planung rüstet Hauptpunkte mit Messeinrichtungen aus. Der Prüfer kontrolliert z.B.:
Wärmemengenzähler: Bei Fernwärme Pflicht, aber auch intern kann man WMZ vorsehen, etwa um Teilverbräuche Halle vs. Büro zu monitoren (Energiemanagement). Steht im Plan so etwas? (Optional, aber FM freut sich, da Energiecontrolling so erleichtert wird).
Thermometer/Manometer: An zentralen Vor- und Rückläufen sollten lokale Thermometer und Druckmesser sein (auch redundant zu Sensoren). Der Plan hat oft kleine Symbole „T“ und „P“ an den Sammlern. Fehlen die, entgeht dem Betreiber einfache Kontrolle. Also anregen falls nötig.
Füllstand/Leckageüberwachung: Bei großen Pufferspeichern evtl. ein Füllstandmesser. Bei Tiefgaragenleitungen vllt. Leckage, aber hier unwahrscheinlich.
Gasdetektion: Wichtiger Mess-Aspekt: Gas-Warner in Heizräumen (explosionsfähige Atmosphäre). Wenn Gasheizung, sollte ein Gaswarnmelder mit Sensor und Alarm vorgesehen sein. Prüfer schaut ob im Elektro/MSR-Teil sowas erwähnt (oft Planer TGA gibt’s an Elektro weiter, aber zumindest anmerken).
Gebäudeleittechnik (GLT) Einbindung: Wie aus VDI 3814 gefordert, sollte die Heizungsanlage überwacht und steuerbar sein. Konkrete Prüfpunkte:
Kommunikation: Welche Protokolle/Schnittstellen? Z.B. Kesselanlage hat Modbus-Schnittstelle, die an die GLT geht. Oder ein DDC-Controller (freiprogrammierbar) bedient alle Ventile und kommuniziert per BACnet/IP an die zentrale FM-Leitstelle. Der Prüfer sucht in Unterlagen, ob sowas beschrieben ist.
Bedienung: Gibt es lokal ein Bedienpanel vs. nur Fernbedienung? Der Betreiber (FM) möchte klar wissen, ob er vor Ort was einstellen kann oder nur via Software. Falls GLT-lastig: sind die Parameter auf GLT parametrierbar? (z.B. Heizkurve verstellen).
Alarme und Störmeldungen: Ein absolutes Muss: Kesselstörung, WP-Störung, Pumpenausfall – all das muss gemeldet werden. Die Planung sollte aufführen, welche Meldungen auflaufen. In kleinen Projekten vielleicht einfach über Sammelstörung. In großen detailliert. Der Prüfer hakt nach: „Wohin geht die Kesselstörmeldung? Ist ein 24/7-Alarmplan vorgesehen?“ – FM-technisch relevant, vor allem im Winter, um ungeplantem Ausfall vorzubeugen. VDI 3814/GA erfordert, dass solche sicherheits- und komfortrelevanten Meldungen entsprechend priorisiert behandelt werden.
Notbetriebsprogramme: Gibt es bei GA-Ausfall oder Sensorfehler eine Backup-Logik? (z.B. Not-Heizbetrieb mit fix 70 °C Vorlauf, falls Außentemperaturfühler defekt – viele Regler haben sowas). Das sind Feinheiten, die in der Ausführungsplanung selten dokumentiert, eher im späteren Reglerhandbuch. Der Prüfer wird es also nur am Rande erwähnen, nicht zwingend fordern, solange er weiß, dass ein Markenregler i.d.R. sowas hat.
Sicherheit durch Automation: Hier überschneidet sich das Thema GA mit Sicherheitsfunktionen:
Begrenzungen: Hochtemperaturbegrenzung in FB-Heizkreis (Fühler im Vorlauf mit Abschaltung bei > 50 °C, um Boden nicht zu überhitzen). Ist der Fühler da? Der Prüfer checkt im Schema.
Kessel und Brennersteuerung: Moderne Kessel haben interne Steuerungen mit Flammenwächter etc. Nicht im Plan detailliert, aber man sieht z.B. „Kessel mit eigener Regelung“ im Konzept.
Frostschutz: GA sollte auch sehen, wenn ein Bereich zu kalt wird (z.B. < 5 °C in einem Abstellraum – Gefahr von Frostschäden) und dann notfalls Pumpe aktivieren. Der Prüfer fragt evtl. ob es Frostschutzthermostate an kritischen Stellen gibt (Tore, Nordwände).
Brandschutz: In seltenen Fällen wird über GA z.B. im Brandfall Heizungsabschaltung gemacht (z.B. Lüftungsanlagen fahren aus, Heizung kann weiter, aber Gasventil könnte im Brandfall schließen um Explosionsgefahr zu mindern). Wenn Projektspezifisch relevant, fragen: Hat BMZ eine Schnittstelle zur Heizung? (Oft nein, aber wenn Gasflaschen etc., evtl. ja).
Dokumentation der MSR:
Für Freigabe wird meist verlangt: MSR-Funktionsliste, Regelschema, evtl. Softwarefunktionsbeschreibung – sofern vorhanden. Der Prüfer vermerkt, ob das vorliegt. Wenn der Planer das erst dem MSR-Unternehmer überlassen will, wäre das zu spät – Planer muss die Grundfunktionen vorgeben (Leistungsphase 5/6). Andernfalls wäre es kein durchdachtes Konzept.
Zusammengefasst zielt die GA-Prüfung darauf ab, dass die Heizungsanlage im Betrieb automatisch und optimal läuft, der Betreiber die Kontrolle hat und bei Störungen gewarnt wird. Nur dann erreicht man das Ziel von Effizienz und Ausfallsicherheit, das in FM-Strategien gefordert wird.
Mögliche Feststellungen: „Außenfühler nicht vorgesehen – ohne Witterungsführung ineffizient, daher ergänzen.“, „Kein Konzept zur Kessel-WP-Kaskade beschrieben – dringend nachreichen, sonst unklarer Parallelbetrieb.“, „GLT: Sicherstellen, dass Hauptalarme (Heizung aus, Frostgefahr) in Leitwarte auflaufen.“. Oft sind Planer in dem Bereich etwas knapp, hier muss der Prüfer als Anwalt des Betreibers auftreten und nötigenfalls insistieren.
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit
Prüfpunkt: Wurden Maßnahmen zur Energieeinsparung und Nachhaltigkeit im Heiztechnik-Konzept berücksichtigt, und entspricht die Planung den aktuellen Effizienzstandards?
Dieser Punkt ist teilweise eine Zusammenfassung vorheriger, aber mit speziellem Fokus auf Energieverbrauch und Umweltverträglichkeit:
Einhaltung energetischer Kennwerte (GEG-Nachweis): Bereits angesprochen – der Planer muss einen Energieausweis für den Neubau führen, worin der Primärenergiebedarf ermittelt wird. Die Heizungsanlage beeinflusst diesen stark (via Wirkungsgrad, regenerative Anteile). Der Prüfer zieht idealerweise den vorläufigen GEG-Nachweis heran und checkt: Liegt der Primärenergiebedarf unter dem Referenzwert? Wurde der WP-Strom renewable angenommen etc.? Besonders wichtig: Der Anteil erneuerbarer Wärme muss nachgewiesen sein (65 %-Regel). Falls Hybrid, kann das z.B. über eine Berechnung nach § 36 GEG (Erneuerbare-Energien-Anteil) erfolgen. Der Prüfer fordert diesen Nachweis, sofern vom Planer noch nicht beigefügt.
Jahresarbeitszahl (JAZ) Wärmepumpe: Für WP gibt es das Kriterium, dass die Jahresarbeitszahl hoch genug sein sollte (i.d.R. > 3,5–4), sonst ist das System ineffizient und verfehlt u.U. GEG-Vorgaben. Planer berechnen JAZ nach VDI 4650. Der Prüfer fragt nach den JAZ-Werten. Sind diese niedrig, muss man Ursachen klären (evtl. zu hohe Vorlauftemp., schlechter Quellenwirkungsgrad).
Pumpen und Motoren Effizienz: Alle Umwälzpumpen sollten der Energieeffizienzklasse entsprechen (meist “EEI ≤ 0,23” oder ähnlich). Das ist teilweise gesetzlich vorgegeben. Der Prüfer prüft die Fabrikate, aber meist kann er sich auf Konformität verlassen.
Hydraulischer Abgleich und Teillastoptimierung: Der hydraulische Abgleich ist letztlich auch eine Effizienzmaßnahme (verhindert Überversorgung und unnötigen Pumpenstrom). Wurde schon geprüft. Teillast: Hat das System z.B. Brennwertkessel modulierend von 20–100 %? Besser als alter Kessel 2-stufig. WP mit Inverter? So was ist im Datenblatt erkennbar. Effizienzfördend. Der Prüfer lobt modulare Konzepte, kritisiert On-Off-Konzepte.
Wärmedämmung: Alle Wärme führenden Teile müssen gedämmt sein per GEG. Der Prüfer wirft einen Blick auf die Ausschreibung/Plan: sind Rohrdämmungen spezifiziert (Dicken nach EN EV/GEG, z.B. 100 % gemäß Tabelle 8 GEG)? Wenn Lücken, nachhaken. Auch Armaturen sollte man dämmen (nicht gesetzlich gefordert zu 100 %, aber Stand der Technik).
Wärmerückgewinnung: Gibt es Möglichkeiten der Rückgewinnung? In reiner Heizung evtl. nicht, aber falls z.B. Drucklufterzeugung im Betrieb Abwärme hat – wurde die evtl. in Heizsystem eingespeist? Oder Abwärme von Kühlprozessen? Solche Querschnittsthemen sollten im Konzept betrachtet werden. Der Prüfer erkundigt sich, ob Abwärmequellen identifiziert wurden. Es ist Teil nachhaltiger Planung, keine Energie ungenutzt zu lassen.
Solarthermie oder andere Erneuerbare: Wurde solarthermische Unterstützung geprüft? Auf Dach Bürotrakt Kollektoren? Oder Einsatz von Biomasse (Holzpelletskessel) als Alternative? Eventuell hat der Planer in frühen Phasen Variantenstudien gemacht. Für die Ausführungsplanung ist die Entscheidung aber getroffen. Der Prüfer kann höchstens feststellen, ob die getroffene Wahl den Effizienzzielen genügt. Z.B. wenn Gasheizung ohne weiteres → prinzipiell inzwischen problematisch wegen GEG. Aber in Hybrid mit WP okay. Solche Dinge muss er evaluieren.
Lebenszyklus und Betriebskosten: Effizienz bezieht sich auch auf Kosteneffizienz. Der Prüfer kann nach einer Wirtschaftlichkeitsrechnung fragen (z.B. WP vs Gas Kostenvergleich). Das ist optional, oft in früher Phase gelaufen. Aber wenn die FM-Abteilung beteiligt war, hat sie u.U. genau auf Lebenszykluskosten geachtet. Hier in der Prüfanweisung kann festgehalten werden: „Die geplante Heiztechnik soll langfristig wirtschaftlich sein; eventuelle Optimierungspotentiale (z.B. bessere Regelstrategie, zusätzliche Dämmmaßnahmen) sind zu identifizieren.“
Nachhaltigkeitsstandards: Falls das Gebäude eine Zertifizierung (DGNB, LEED) anstrebt, gibt es Punkte für besonders effiziente Anlagentechnik, niedrige CO₂-Emissionen etc. Der Prüfer müsste sicherstellen, dass die Planung die dafür nötigen Daten liefert (CO₂-Faktor, Kühlmittel WP, etc.). Diese Details gehen sehr ins Nachhaltigkeitsmanagement, werden aber hier der Vollständigkeit erwähnt.
Zukunftsfähigkeit: In Einklang mit FM-Strategie sollte die Heizungsanlage flexibel anpassbar sein. Z.B. Umstellung auf andere Brennstoffe (kann der Kessel Bio-Gas oder H₂-beimischung? Hat WP Reserve, um mit PV-Strom zu arbeiten?). Der Prüfer kann bewerten, ob z.B. Wasserstofftaugliche Kessel gewählt wurden (manche neue Gasthermen sind bis 20 % H₂ geeignet). Oder ob Leittechnik offen ist für Erweiterung. Das ist kein harter Muss, aber fließt in die Empfehlung ein.
Hier werden die Prüfergebnisse oft in Narrative zusammengefasst statt harter Zahlen: Etwa „Die Heizungsanlage entspricht dem Stand der Technik in Bezug auf Effizienz; insbesondere durch Einsatz einer Wärmepumpe wird der Fossileinsatz reduziert. Der hydraulische Abgleich und geregelte Pumpen sorgen für minimalen Stromverbrauch. GEG-Anforderungen werden eingehalten (Primärenergiebedarf 15 % unter Grenzwert laut Nachweis). Weiteres Potential: Nutzung von PV-Strom in WP-Betrieb optimieren.“. Solche Formulierungen können Teil des Prüfgutachtens sein und dienen dem Bauherrn als Bestätigung, dass seine Anlage zukunftssicher ist.
Sollte etwas negativ auffallen, etwa „Ausschließlicher Gaskessel nicht zukunftssicher hinsichtlich Klimaschutz – Nachbesserung empfohlen“, würde das im Lichte neuer Gesetze sicherlich beanstandet. Aber in unserem Fall hat man ja WP drin, also sollte es passen.
Redundanz, Ausfallsicherheit und Betriebssicherheit
Prüfpunkt: Sind ausreichende Vorkehrungen getroffen, um den Heizbetrieb auch bei Ausfall einzelner Komponenten oder in Störfällen aufrechtzuerhalten, und erfüllt die Anlage alle sicherheitstechnischen Anforderungen?
Industriebauten haben oft Anforderungen an Verfügbarkeit – z.B. dürfen Produktionsprozesse nicht einfrieren, oder ein Bürogebäude soll auch bei einem Kesselausfall nicht komplett unbeheizt sein (Schutz der Bausubstanz und Mitarbeiterkomfort).
Daher liegt Augenmerk auf:
Redundante Wärmeerzeuger: Im Plan erkennt man Redundanz, wenn z.B. mehrere Kessel vorhanden sind. Unser Plan hat Kessel + WP, also eine Art Redundanz (zwei Systeme). Prüfer bewertet: Falls einer ausfällt, kann der andere genug “Notheizen”? Im Winter, WP out, Gas an – Gas hat volles modulierendes Spektrum, sollte packen, ja. Wenn Gas ausfällt, WP kann wahrscheinlich nicht allein − sagen wir Gas 500 kW, WP 100 kW, dann WP allein reicht nicht, Gebäude wird kalt. Somit wäre streng genommen keine vollwertige Redundanz, da WP eher Grundlast. Der Prüfer sollte auf diesen Punkt hinweisen: „Im Falle eines Gaskesselausfalls kann die WP nur etwa 20 % der Maximalleistung decken; kritische Bereiche sollten definierte Frostschutzheizkörper (z.B. elektr.) vorhalten oder zweiter Kessel erwogen werden.“. Es ist dann eine Risikoabwägung, ob Gas so zuverlässig (idR ja, aber Brennerausfall kann immer sein).
Redundante Wärmeerzeuger:
Redundanz ist auch relevant bei Pumpen (wie erwähnt, Doppelpumpen).
Und bei Stromversorgung: Hat das Gebäude Notstrom? Falls ja, ist die Heizanlage drauf? Üblich in Gewerbe: Notstrom versorgt Sicherheitsbeleuchtung, IT, aber Heizung oft nicht. Wenn Notstromaggregat genug Reserve hat, könnte man minimal Pumpen draufnehmen, um Frost zu schützen. Der Prüfer fragt, was passiert bei Stromausfall längerer Zeit. Im Winter kann in 2–3 Stunden schon Frostschäden drohen in Sprinkler oder peripheren Räumen.
Notfallbetrieb: Gibt es einen manuellen Notbetrieb? z.B. Gasbrennwertkessel können oft hydraulisch und elektrisch überbrückt werden, falls z.B. Regelung defekt – das macht aber in Praxis keiner ohne Fachwissen. Der Prüfer setzt eher auf Redundanz als auf “Handbetrieb”.
Instandhaltungsfreundlichkeit (redundanz in Wartung): Kann man einen Kessel warten, während der andere läuft? Ja, wenn zwei Kessel. Sind Absperrarmaturen vorhanden, um Pumpen, WT etc. isolieren zu können, ohne das gesamte System zu entleeren? Das hatten wir, nennt man auch Wartungsfreundlichkeit. Prüfer hackt hier auf: „Absperrschieber vor jedem großen Anlagenteil vorhanden – gut.“ Oder „Kein Bypass für Pumpentausch – Anlagenteil müsste entleert werden im Falle – anregen, zusätzlich Schieber einzubauen.“ (in Planungsphase ohne großen Kostenaufwand machbar).
Sicherheitsventile und Entlastungseinrichtungen: Wurde schon geprüft, aber nochmals: Jedes geschlossene System hat SV. Sind diese korrekt dimensioniert (Fachinfo: Durchflussleistung, aber man vertraut Hersteller). Der Prüfer achtet aber auf Position: SV immer am Kessel oder Wärmetauscher Ausgang (heißester, druckintensiver Punkt) – das passt in Plan? Falls mal nur eins zentral am Pufferspeicher gezeichnet, aber Kessel vom Puffer per Ventil trennbar – dann riskant, Kessel ohne SV falls Ventil zu. Also hat Kessel intern SV oder extern fix an Kesselvorlauf, darf kein absperrventil dazwischen! Das sind lebenswichtige Details.
Temperatur- und Druckbegrenzer: Oft hat Kessel eine max. Temperaturabschaltung bei 110 °C, WP hat Frostschutz an Verdampfer. Der Prüfer wird sicher sein wollen, dass z.B. in FB-Heizung ein Sicherheits-Thermostat (Begrenzer) da ist, falls Mischer klemmt. Solche Begrenzer sind manchmal separate Kästchen, manchmal in Elektronik mit drin. Der Plan sollte immerhin die Fühler zeigen.
Brandschutz: Der Heizungsplan muss kompatibel sein mit dem Brandschutzkonzept:
Wanddurchführungen von Rohren >= DN 110 durch Brandabschnitte müssen Brandabschottungen haben (DIN 4102 oder MLAR). Der Prüfer sieht, ob das thematisiert ist (manchmal Vermerk: „alle Deckendurchführungen feuerwiderstandsfähig auszuführen.“).
Brennstoffversorgung: Gasleitung in den Heizraum – Gasabsperrmagnet im Brandfall aus? Je nach Gasregelung Standard, in sensiblen Bereichen ja.
Abgasanlagen feuerbeständig? Brennwert-Abgas ist i.d.R. Kunststoff in Schächten – Schacht muss feuerbeständig sein.
Falls Öllagerung, wären Brandschutzwannen etc., aber hier Gas/WP.
Hallenheizung: Deckenstrahlplatten haben hohe Oberflächentemp? Normal okay, keine Brandlast an sich, aber Gas-Dunkelstrahler (hier nicht der Fall) müssten z.B. unter Rauchmeldern oder Abständen etc. Wenn Sprinkleranlage, muss Strahlplatte Abstand zum Sprinkler, sonst beeinflusst ihn. Prüfer muss interdisziplinär denken: „Heizgerät darf Sprinkler nicht auslösen oder behindern“.
Gefahrstoffe: Heizung i.d.R. keine großen Gefahrstoffe außer Heizöl (nicht hier) oder evtl. Glykol im Solekreis (giftig?). Wenn WP Sole mit Ethylenglykol – giftig, aber minimal. FM will evtl. Propylenglykol (nicht toxisch) – war das in Plan festgelegt? Kleiner Punkt, aber im FM Umfeld relevant.
Betriebssicherheit allgemein: Es wird geschaut, ob die Anlage robust ist: Nicht zu kompliziert (je komplexer, desto störanfälliger). Im Zweifel: Ist Personal qualifiziert? (VDI 2035 erfordert Fachbetriebe, VDI 6023 (Trinkwasser) analog – aber das ist Sache der Ausführung).Die Prüfer aus FM-Sicht bevorzugen oft robuste Standardlösungen, um ungeplante Ausfälle zu minimieren. Z.B. wenn eine innovative Steuerung zwar energiesparend ist, aber sehr fehleranfällig, könnte FM das kritisch sehen. Solche Abwägungen fließen in die Empfehlung ein.
In dem Prüfkapitel wird letztlich bewertet: “Wie zuverlässig wird die Anlage laufen? Was passiert, wenn doch etwas ausfällt?” – Gibt es schnelle Eingreifmöglichkeiten (z.B. GLT-Alarm, Hausmeister kann Notbetrieb einschalten, Ersatzteile vorrätig)?
Die Prüfanweisung kann auch empfehlen, schon in der Planung an Wartungsverträge oder Servicekonzepte zu denken. Z.B. einen Hinweis: „Für die Gastherme wird empfohlen, einen 24h-Servicevertrag mit dem Hersteller abzuschließen, um im Störungsfall rasche Hilfe sicherzustellen.“ Solche Hinweise gehen über die reine Planung hinaus, aber sind aus FM-Sicht wertvoll.
Nach Durcharbeiten aller obigen Punkte hat der Prüfer ein vollständiges Bild. Mängel und Verbesserungen sind dokumentiert. Im Folgenden wird dies in einer Checkliste strukturiert zusammengefasst, die als praktisches Werkzeug für die Prüfverantwortlichen dient.
Prüftabelle (Checkliste Heiztechnik Ausführungsplanung)
Nachstehend findet sich eine tabellarische Checkliste aller wesentlichen Prüfpunkte, wie sie von einem FM-Prüfverantwortlichen während der Planungsfreigabe durchgegangen werden kann. Jeder Punkt kann mit erfüllt/nicht erfüllt abgehakt und mit Bemerkungen versehen werden. Diese Tabelle gewährleistet eine durchgehende, strukturierte Prüfung gemäß den vorigen Kapiteln.
Checkliste
| Prüfbereich | Prüfkriterium / Frage | Erfüllt? | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Unterlagen | Sind alle erforderlichen Planungsunterlagen vorhanden (Pläne, Schemata, Berechnungen, Stücklisten, technische Daten)? | □ Ja / □ Nein | |
| Sind die Unterlagen konsistent (übereinstimmende Angaben in Plänen, Schemen und Berechnungen)? | □ Ja / □ Nein | ||
| Entsprechen Detaillierungsgrad und Inhalt der LP5 (Ausführungsreife, klare Anweisungen für die Ausführung)? | □ Ja / □ Nein | ||
| Gesetze/ Normen | GEG: Werden die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes erfüllt (65% EE-Anteil, Primärenergie, Dämmstandard)? | □ Ja / □ Nein | Angabe EE- |
| DIN EN 12831: Liegt eine vollständige Heizlastberechnung vor und wurde diese normgerecht durchgeführt? | □ Ja / □ Nein | Heizlast gesamt: … kW | |
| DIN EN 14336: Sind Inbetriebnahme, Spülung und Druckprüfung in Planung berücksichtigt (Entlüfter, Spülstutzen, Prüfdruck)? | □ Ja / □ Nein | Prüfdruck: … bar | |
| VDI 2035: Ist die Wasserqualität berücksichtigt (Härte, Korrosionsschutz)? Wird Wasseraufbereitung vorgesehen? | □ Ja / □ Nein | Maßnahme: … | |
| VDI 3814 / GA: Ist die Integration in die Gebäudeautomation geplant (Datenpunkte definiert, Schnittstellen vorhanden)? | □ Ja / □ Nein | System: … (z.B. BACnet) | |
| VOB/C DIN 18380: Entspricht die Planung den ATV-Anforderungen (Dichtheitsprüfung, Dämmung, Materialwahl etc.)? | □ Ja / □ Nein | ||
| Heizlast & Auslegung | Stimmen die angesetzten Randbedingungen der Heizlast (Außentemp., Innentemp., Lüftung) mit Projekt und Norm überein? | □ Ja / □ Nein | Außentemp.: … °C |
| Sind die berechneten Heizlasten plausibel (Vergleich mit Erfahrungswerten, pro m²)? | □ Ja / □ Nein | max. … W/m² (Raum …) | |
| Decken die dimensionierten Wärmeerzeuger die Heizlast mit angemessener Reserve? (Angaben kW vs. kW) | □ Ja / □ Nein | Last: … kW, Erzeuger: … kW | |
| Wurden Zuschläge oder Reserven nachvollziehbar berücksichtigt (z.B. +10 % Reserve, Torluftverluste)? | □ Ja / □ Nein | Zuschlag: … %/keine | |
| Sind die Heizkörper/Heizflächen gemäß Raumheizlast ausgelegt (Leistung ≥ Raumlast)? | □ Ja / □ Nein | Stichprobe Raum … | |
| Hydraulischer Abgleich: Sind Einstellventile/Voreinstellungen für jeden Strang/Heizkörper vorgesehen? | □ Ja / □ Nein | Art: Thermostatventile etc. | |
| Wärmeer-zeugung | Kessel/WP: Ist die Leistungsauslegung passend (inkl. Teillastverhalten, min./max. Last, ggf. Kaskade)? | □ Ja / □ Nein | Modulationsbereich: … |
| Wurden erneuerbare Energien berücksichtigt (Wärmepumpe, solar etc.) entsprechend Vorgabe (≥65 %)? | □ Ja / □ Nein | System: … | |
| Gas-Heizanlage: Entspricht die Aufstellung den Vorschriften (Heizraumgröße, Verbrennungsluft, Abgasführung)? | □ Ja / □ Nein | Lüftungsöffnungen: … | |
| Sind sämtliche Sicherheitseinrichtungen am Erzeuger vorhanden (Sicherheitsventil, MAG, Abscheider, Entlüfter)? | □ Ja / □ Nein | MAG-Größe: … L | |
| Fernwärme (falls zutreffend): Ist die Art des Anschlusses (direkt/indirekt) geklärt und Station gemäß Versorgerforderung geplant? | □ Ja / □ Nein | Art: □ direkt / □ indirekt | |
| Wärmepumpe (falls vorhanden): Ist die Quellenanlage (Luft/Sole) dimensioniert und auf Aufstellbedingungen geprüft (Schall, Frost)? | □ Ja / □ Nein | JAZ: … / Schall: … dB(A) | |
| Sind für alle Wärmeerzeuger die Wartungszugänge und ausreichende Abstände vorgesehen (für Brennerwartung, Wärmetauscherreinigung etc.)? | □ Ja / □ Nein | Freiraum vorn: … m | |
| Verteilung/ Hydraulik | Ist ein vollständiges Hydraulikschema vorhanden, das alle Kreise, Pumpen, Ventile, Speicher abbildet? | □ Ja / □ Nein | Plan-Nr.: … geprüft |
| Passen Rohrdimensionen zu den Volumenströmen (Geschwindigkeiten im Rahmen, z.B. < 2 m/s in Hauptleitungen)? | □ Ja / □ Nein | max. … m/s in DN … | |
| Sind Pumpen richtig ausgewählt (Förderstrom/-höhe deckt Berechnung, Effizienzpumpen mit FU)? | □ Ja / □ Nein | Pumpentypen: … | |
| Hat jeder Hauptkreis eigene Pumpe und Regelarmatur (Mischer) gemäß Erfordernis (z.B. Fußbodenheizung mit Mischer)? | □ Ja / □ Nein | Kreise: … | |
| Gibt es eine hydraulische Entkopplung (Weiche oder Pufferspeicher) zwischen Erzeugern und Verbrauchern, sofern nötig (bei Mehrkessel/WP)? | □ Ja / □ Nein | Art: … / □ nicht nötig | |
| Sind Ausdehnungsgefäße für das gesamte Anlagenvolumen ausreichend dimensioniert und angeordnet (keine Absperrung zw. Kessel und MAG)? | □ Ja / □ Nein | Berechnung vorh.: □ ja/□ nein | |
| Wurden alle erforderlichen Absperr- und Regelventile eingeplant (Absperrer vor Pumpen/WT, Strangregulierventile etc.)? | □ Ja / □ Nein | ||
| Sind alle Rohrleitungsdurchführungen und Aufhängungen geplant (inkl. Festpunkte, Gleitpunkte, Kompensation)? (Betrifft Montageplanung, aber Indiz in Ausführungsplänen) | □ Ja / □ Nein | ||
| Rohrnetz-Wärmedämmung: Sind Vorgaben für Dämmdicken entsprechend GEG/VOB gemacht (Material, Stärken)? | □ Ja / □ Nein | Angabe: … mm | |
| Wärmeabgabe | Heizkörper: Sind Typ, Größe und Anzahl je Raum ausgewiesen und entsprechen sie der Berechnung (mit passender VL/RL-Temp)? | □ Ja / □ Nein | Stichpr. Raum … ok |
| Sind die Heizkörper korrekt positioniert (i.d.R. unter Fenstern) und wird ihre Umgebung (Nischen, Verkleidungen) berücksichtigt bzgl. Leistung? | □ Ja / □ Nein | ||
| Verfügt jeder Heizkörper über ein Thermostatventil bzw. Stellantrieb zur individuellen Regelung? | □ Ja / □ Nein | Art: □ manuell / □ motorisch | |
| Fußbodenheizung: Liegt ein Verlegeplan bzw. Konzept (Rohrabstand, Kreislängen) vor und sind Vorlauftemperaturen begrenzt (Mischerkreis)? | □ Ja / □ Nein | VL max: … °C | |
| Sind die FB-Heizungsverteiler strategisch günstig platziert (zentral pro Zone, zugänglich) und mit Durchflussanzeigern/Regelventilen ausgestattet? | □ Ja / □ Nein | Anzahl Verteiler: … | |
| Deckenstrahlplatten: Ist die Anzahl/Fläche ausreichend für Hallenheizung und sind sie gemäß Herstellerangaben (Höhe, Leistung) dimensioniert? | □ Ja / □ Nein | Fläche: … m², Leistung/Stk: … kW | |
| Sind die Strahlplatten zonenweise regelbar und in Absprache mit Nutzung positioniert (über Arbeitsplätzen, nicht über offenen Toren)? | □ Ja / □ Nein | ||
| Lufterhitzer: Sind Leistung und Luftvolumen der Warmlufteinheiten den Raumanforderungen angepasst (Wurfweite, Montagehöhe)? | □ Ja / □ Nein | Gerätetyp: …, kW: … | |
| Sind für die Lufterhitzer geeignete Steuerungen vorgesehen (Thermostat, Stufenschaltung, evtl. Türkontaktsteuerung)? | □ Ja / □ Nein | Steuerung: … | |
| Wurden alle Sonderbereiche bedacht (z.B. Frostschutz in Technikräumen, Begleitheizung für gefährdete Leitungen, heiztechnische Anbindung von Lüftungsanlagen)? | □ Ja / □ Nein | Bereich: … vorgesehen | |
| MSR / Automation | Liegt ein Steuer- und Regelungsschema bzw. eine Funktionsbeschreibung vor, aus der die Regelstrategie hervorgeht? | □ Ja / □ Nein | Dokument: … geprüft |
| Außentemperaturfühler vorgesehen für witterungsgeführte Regelung? | □ Ja / □ Nein | ||
| Zeitschaltprogramme vorgesehen für Nutzungszeiten (Nachtabsenkung, Wochenende)? | □ Ja / □ Nein | Art: □ Kesselregler / □ GLT | |
| Sind alle Heizkreise mit entsprechenden Fühlern und Stellgliedern ausgerüstet (Vorlauftemp.-Fühler, Mischer mit Motor, Raumfühler wo nötig)? | □ Ja / □ Nein | ||
| Kaskaden-/Hybridregelung: Ist die Steuerung mehrerer Erzeuger (Kessel + WP) konzipiert, inkl. Priorisierung und bivalenten Punkt? | □ Ja / □ Nein | Beschreibung vorhanden: □ ja/□ nein | |
| Gebäudeautomation: Sind Schnittstellen zur GLT definiert (Protokoll, Datenpunktliste) und werden Hauptbetriebsdaten übertragen (Temperaturen, Stellungen, Zähler)? | □ Ja / □ Nein | Schnittstelle: … | |
| Werden Störungen und Alarmmeldungen weitergeleitet (z.B. Kesselstörung, Pumpenausfall an GLT bzw. SMS-Service)? | □ Ja / □ Nein | Alarmkonzept: … | |
| Ist die Fernüberwachung/Remote-Zugriff für den Betreiber vorgesehen (z.B. VPN zur Heizungsregelung, Hersteller-Fernwartung)? | □ Ja / □ Nein | ||
| Sind Notfallroutinen eingerichtet (Frostschutz bei Ausfall von Steuerungen – z.B. Not-Handbetrieb, Sicherheitssteuerung)? | □ Ja / □ Nein | Maßnahmen: … | |
| Energie-effizienz | Erreicht die geplante Anlage die angestrebten Energiekennwerte (Primärenergiebedarf gemäß Nachweis, ggf. Zertifizierungsziel)? | □ Ja / □ Nein | Wert: … kWh/(m²a) |
| Ist die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe nachgewiesen und ausreichend hoch (> …)? | □ Ja / □ Nein | JAZ: … | |
| Wurden hocheffiziente Pumpen und Regelstrategien (drehzahlgeregelt, hydraulischer Abgleich) eingeplant, um Stromverbrauch zu minimieren? | □ Ja / □ Nein | Pumpe EEI: … | |
| Sind alle Wärmeverteilkomponenten gedämmt und Verluste minimiert (auch Armaturen soweit möglich)? | □ Ja / □ Nein | Dämmstandard: … | |
| Nachhaltigkeit: Wurden ggf. erneuerbare Zusatzsysteme (Solarthermie, Abwärmenutzung) integriert oder vorbereitet? | □ Ja / □ Nein | System: … / □ nicht vorgesehen | |
| Ist die Anlage für zukünftige Entwicklungen ausgelegt (z.B. H₂-ready Kessel, Anschlussoption für weitere Quellen, Erweiterungsreserven)? | □ Ja / □ Nein | Besonderheit: … | |
| Redundanz/Sicherheit | Besteht für die Wärmeerzeugung eine Redundanz (N+1 Konfiguration o. ä.) oder zumindest ein Notkonzept bei Ausfall (z.B. zweiter Kessel, Notheizer)? | □ Ja / □ Nein | Beschreibung: … |
| Sind wichtige Pumpen redundant ausgeführt oder alternative Versorgungswege vorhanden (z.B. Ringnetze)? | □ Ja / □ Nein | Pumpenredundanz: … | |
| Sind im Heizraum/Anlagenraum Gaswarner, Not-Aus Schalter und Lüftung nach TRGI vorgesehen (bei Gasfeuerung)? | □ Ja / □ Nein | □ N/A (keine Gasfeuerung) | |
| Entsprechen die Abgas- und Verbrennungsluftführungen den Sicherheitsvorschriften (korrekte Dimension, Material, Abstände – Nachweis z.B. nach EN 13384)? | □ Ja / □ Nein | Schornsteinberechnung: □ ja/□ nein | |
| Sind Brandschutzmaßnahmen umgesetzt (Absperrungen durch Brandwände mit Zertifikat, feuerbeständige Leitungen, Abschaltung bei Brandalarm falls nötig)? | □ Ja / □ Nein | Maßnahmen: … | |
| Wurden Anforderungen aus dem Brandschutzkonzept berücksichtigt (Heizraum als eigener Brandabschnitt, Tür T30, kein unzulässiges Brennstofflager)? | □ Ja / □ Nein | Heizraum: □ eigene Zelle | |
| Sind alle Sicherheitseinrichtungen (Druckbegrenzer, Temp.-Begrenzer, Überströmventile, Sicherheitsventile) vorhanden und richtig platziert/dimensioniert? | □ Ja / □ Nein | Anzahl SV: …, Einstelldruck: … bar | |
| Ist die Anlage gegen Frostschäden geschützt (Frostschutzthermostate in gefährdeten Bereichen, Notstrom für Pumpen oder Entleerungskonzept bei längeren Stillstand)? | □ Ja / □ Nein | Konzept: … | |
| Wartung/Zugänglichkeit: Sind alle Bauteile zugänglich für Service (Wartungsgänge, Zugang zu Ventilen in Schächten, keine Einmauerung etc.)? | □ Ja / □ Nein | Engstellen: … | |
| Ist im Plan eine Dokumentation der Anlagentechnik vorgesehen (Betriebs- und Wartungsanleitung, Protokolle gemäß DIN 14336, Schulung des Bedienpersonals)? | □ Ja / □ Nein | Unterlagenübergabe: □ geplant | |
| Abschluss | Wurden alle obigen Prüfpunkte ohne kritische Mängel erfüllt, so dass eine Freigabe der Heizungs-Ausführungsplanung erteilt werden kann? | □ Ja / □ Nein | Gesamteindruck: … |
Legende: □ = ankreuzen, N/A = nicht anwendbar.
Diese Checkliste soll dem Prüfer helfen, nichts zu übersehen, und sie bietet dem Auftraggeber zugleich Nachvollziehbarkeit der Prüfung. Jeder festgestellte Mangel ist in der „Bemerkungen“-Spalte zu erläutern, idealerweise mit Verweis auf die entsprechende Norm oder Anforderung. Die Prüftabelle spiegelt die in dieser Prüfanweisung erläuterten Inhalte wider und kann projektspezifisch ergänzt oder angepasst werden.
